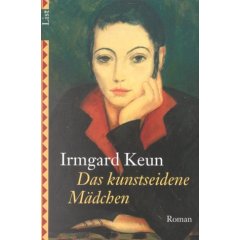 OA 1932 Form Roman Epoche Moderne
OA 1932 Form Roman Epoche Moderne
Das kunstseidene Mädchen, ein typisches Werk der Neuen Sachlichkeit, ist ein Zeit- und Großstadtroman über die letzten Tage der Weimarer Republik. Aus der Sicht einer scheinbar naiv-durchtriebenen Ich-Erzählerin, des kunstseidenen Mädchens Doris, vermittelt Irmgard Keun ein hautnahes Bild der Alltagsmisere einer kleinen Büroangestellten, die ihrem engen Lebenskreis entfliehen will.
Inhalt: Doris arbeitet lustlos im Büro eines Rechtsanwalts. Ihren freudlosen Alltag kompensiert sie mit Tagträumen †“ sie will ein Filmstar werden †“ und mit Abendvergnügungen, bei denen sie die Prüde spielt und ihre diversen Bekanntschaften zu Geschenken animiert. Von ihrer großen Liebe Hubert wurde sie enttäuscht; er verließ sie wegen eines reichen Mädchens, versuchte aber sein Verhalten mit moralischen Bedenken ihr gegenüber zu rechtfertigen. Trotz ihrer Jugend macht sich Doris keinerlei Illusionen über die Liebe, die Männer und den Kaufwert der Liebe. Als sie die Zudringlichkeiten ihres Chefs heftig zurückweist, weil er ihr zu alt ist, wird ihr gekündigt.
Eine kleine Stelle als Statistin am Theater scheint die Erfüllung ihrer Kleinmädchenträume zu ermöglichen. Durch Intrigen erhält sie sogar einen Platz an der Schauspielschule und hat großen Erfolg, als sie bei einer Aufführung einen Satz sprechen darf. Doch nach dem Diebstahl eines Pelzmantels, der sie unwiderstehlich anzieht, flieht sie nach Berlin, ohne zu wissen, wie sie dort überleben kann.
Doris wird konfrontiert mit dem Elend der Arbeiterfamilien, mit Prostitution und Brutalität, ist aber fasziniert von der glitzernden Großstadt und zeigt einen nahezu unerschütterlichen Optimismus. Ob als Kindermädchen, ausgehaltene Geliebte eines Fabrikanten oder Gelegenheitsprostituierte, Doris bleibt sich gleich, macht sich nichts vor und wirkt deshalb auf den Leser sympathisch. Ihre Zuneigung zu einem Kriegsblinden, den sie durch das nächtliche Berlin führt und es ihm mit ihren Augen schildert, offenbart ihre große Hilfsbereitschaft und Güte. Als sie Ernst, einen von seiner Frau verlassenen »anständigen« Mann, kennen lernt, freundet sich Doris aus Liebe sogar mit der Hausfrauenrolle an, die ihr sinnvoller erscheint als nichts sagende Büroarbeit. Dass Ernst seine Frau nicht vergessen kann, schmerzt sie. Doris verlässt ihn und benachrichtigt die Ehefrau, um ihm zu helfen. Am Ende sitzt sie im Wartesaal des Bahnhofs und weiß nicht, wohin sie gehen soll.
Aufbau: Konsequent lässt die Autorin die Ich-Erzählerin als fiktive Tagebuchschreiberin in naivem, schnoddrigem, aber klarsichtigem Ton sprechen; die Figur wirkt hierdurch lebendig und plausibel. Mit einer stilistischen Mischung aus Neuer Sachlichkeit und Sentimentalität gelingt es Keun, ihre Leser direkt anzusprechen. Die Handlung ist nicht chronologisch erzählt, doch die Zeitsprünge †“ Vor- und Rückgriffe †“ sind leicht nachvollziehbar.
Wirkung: Nach dem Sensationserfolg des ersten Romans Gilgi, eine von uns (1931) hätte Das kunstseidene Mädchen Keun den literarischen Durchbruch bringen können †“ trotz der vehementen Proteste rechter und konservativ bürgerlicher Kreise. Die nationalsozialistische Kulturpolitik verhinderte jedoch die Etablierung der Autorin auf dem Buchmarkt und zwang sie ins Exil. Heute gilt Keun als Vorreiterin der Frauenliteratur.
Kurzbeschreibung
Doris ist Sekretärin bei einem zudringlichen Rechtsanwalt. Sie will nicht mehr tagaus, tagein lange Briefe tippen, sondern ein Star werden. Sie will hinaus in die große Welt, ins Berlin der Roaring Twenties . . .
Über die Autorin
Irmgard Keun, geboren am 06.02.1905 in Berlin, gestorben am 05.05.1982 in Köln, ist eine der herausragenden Vertreterinnen des Großstadtromans zur Zeit der Weimarer Republik. Mit analytisch-scharfem, leicht ironisch gebrochenem Blick schilderte sie das Schicksal der kleinen Leute in einer unsicheren Zeit. Die Tochter einer Fabrikantenfamilie wuchs in Berlin und Köln auf. Nach dem Besuch der Schauspielschule arbeitete sie kurzzeitig in diesem Beruf. Ihr erster Roman Gilgi, eine von uns (1931) war ein durchschlagender Erfolg. Keun wurde als Wunderkind gefeiert, zumal sie sich fünf Jahre jünger machte. Die Machtergreifung der Nationalsozialisten bereitete ihrer sich anbahnenden Karriere ein jähes Ende; ihre Bücher, die dem Frauenbild der neuen Machthaber nicht entsprachen, wurden verbrannt. Ende 1935 ging Keun ins Exil nach Belgien und reiste mit Joseph R Roth durch das nicht besetzte Europa, danach versteckte sie sich in den Niederlanden. 1940 lebte sie mit falschen Papieren in Deutschland. In den Nachkriegsjahren als Rundfunkautorin erfolgreich, geriet Keun bald in Vergessenheit. Die Renaissance ihrer Romane um 1980 hat sie noch erlebt. Biografie: H. Beutel/A. Barbara Hagin (Hrsg.), „Einmal ist genug“. Irmgard Keun. Zeitzeugen, Bilder und Dokumente erzählen, 1995; G. Kreis, Was man glaubt, gibt es. Das Leben der Irmgard Keun, 1991; H. Häntzschel, Irmgard Keun
Oh, die habt Ihr hier auch? Dies Buch wurde schon von Tucholsky wohlwollend rezensiert, wenn ich mich nicht irre.
Und ich hatte von Irmgard Keun mal ein geerbtes Kinderbuch mit dem schönen Titel „Das Mädchen, mit dem die Kinder nicht verkehren durften“. Mir hat’s damals gefallen.
Der Roman sei von der Berufsschriftstellerin noch vor ihrem Exil geschrieben worden – schlicht zum Erwerb des Lebensunterhaltes. Das fröhlich geschriebene Buch fordert immer wieder zur Nachdenklichkeit auf. Die zahlreichen Kapitel besitzen einen hintergründigem Humor und handeln von den Streichen und Abenteuern dieses 10-jährigen Mädchens, das nicht bereit ist, die Welt einfach so zu akzeptieren, wie sie angeblich ist. Sie will sich nicht an alle von den Erwachsenen aufgestellten Regeln halten, da sie diese nicht sinnvoll findet und sie sucht, die Welt durch ihre meist gutmütigen Streiche zum Guten zu ändern. Einige Rezensenten meinen, der Roman trage autobiographische Züge. Die Versuche drei Soldaten auf deren Wunsch hin mit Scharlach anzustecken um weiterem Kriegsdienst zu entgehen, ist möglicherweise erfunden, die Eingabe an den Kaiser beruht aber auf Keuns eingereichte Klage gegen die Regierung, das bedingt durch das Bücherverbot verlorene Geld wieder zu bekommen.
Das Buch ist 1936 erschienen, du hast es wohl nicht mehr, oder?
Ich bin gerade dabei die Bücher aus unserem Lesekreis ein wenig herzurichten und dabei über deinen Kommentar gespolpert, wie schön 🙂 …
Hej, hallo dolcevita –
nein, ich hab es schon lange nicht mehr, es muss wie die meisten meiner Kinderbücher von meinen Geschwistern verschleppt oder beim Abriss meines Elternhauses abhanden gekommen sein. Antiquarisch ist es aber noch zu haben (übers ZVAB), falls es jemanden interessiert.
Hab mich eben richtig gefreut über die „9“ statt der „8“ bei den ungelesenen Mails im Ordner „Lesekreis“. Ich bin aber leider noch immer nicht wieder fit.
Melde mich noch per Mail.
Liebe Grüße an die, die mich hier noch kennen 🙂
Anjelka
hej Anjelka!
Meine Bücher sind auch alle verschütt gegangen, sehr ärgerlich, wie ich heute finde. Abgesehen von den Büchern gibt es auch sonst nichts mehr aus meiner Kindheit. Dafür hebe ich jetzt alles auf, das ist auch sehr problematisch und führt zu Platzproblemen 😉
Lass es dir besser gehen und werde schnell wieder gesund,
ganz liebe Grüße