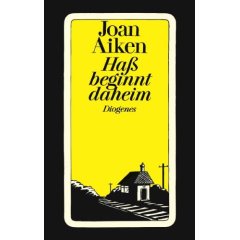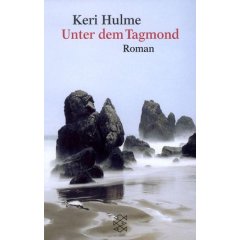Der erste Satz aus Rituale:
An dem Tag, als Inni Wintrop Selbstmord beging, standen die Philips-Aktien auf 149,60.
Der letzte Satz aus Rituale:
Es gab somit unverkennbar zwei Welten: eine, in der die beiden Taads sich aufhielten, und eine, in der sie abwesend waren, und zum Glück befand er sich noch in der letzteren.
 Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom, geboren am 31. Juli 1933 in Den Haag, ist einer der bedeutendsten niederländischen Schriftsteller der Gegenwart.
Cornelis Johannes Jacobus Maria Nooteboom, geboren am 31. Juli 1933 in Den Haag, ist einer der bedeutendsten niederländischen Schriftsteller der Gegenwart.
Sein Werk umfasst Romane, Novellen, Reiseberichte und Gedichte; er war auch als Journalist und Literaturkritiker tätig. Seine Bücher erhielten zahlreiche Preise und wurden in mehr als 15 Sprachen übersetzt.
Durch einen Bombenangriff auf Den Haag verlor Nooteboom 1945 den Vater. Seine Mutter heiratete 1948 erneut; auf Betreiben seines streng katholischen Stiefvaters besuchte Nooteboom daraufhin von Franziskanern und Augustinern geleitete Klosterschulen. Nach eigener Auskunft fühlte er sich dort von der Zeremonialität angezogen, nicht aber von der Dogmatik und er verließ die Schule vorzeitig.
Ab 1950 arbeitete Nooteboom bei einer Bank in Hilversum und nahm Gelegenheitsarbeiten an. 1953 begann er ausgedehnte Reisen durch Europa, häufig als Tramper. Diese Fahrten inspirierten seinen ersten Roman Philip en de anderen (1955; dt.: Das Paradies ist nebenan, 1958); er wurde mit dem Anne-Frank-Preis (1957) ausgezeichnet und in den Schulkanon aufgenommen und machte somit seinen Autor in den Niederlanden unmittelbar bekannt. In Deutschland erreichte er erst in der Neuübersetzung Philip und die anderen (2003) von Helga van Beuningen ein breites Publikum.
1957 heuerte Nooteboom auf einem Schiff in die Karibik als Leichtmatrose an, um in Suriname beim Vater seiner Braut Fanny Lichtveld um deren Hand anzuhalten. Die beiden heirateten entgegen dessen Willen, trennten sich jedoch 1964 wieder. Die Erlebnisse dieser Reise fanden in den Erzählungen des Bands De verliefde gevangene (1958; dt.: Der verliebte Gefangene. Tropische Erzählungen, 2006) Niederschlag.
Nootebooms zweiter Roman, De ridder is gestorven (1963; dt.: Der Ritter ist gestorben, 1996), blieb 17 Jahre lang sein letzter. Bekannt wurden während dieser Zeit hauptsächlich zahlreiche Reiseberichte. Diesen verdankt Nooteboom seinen Ruf als Reiseschriftsteller, obgleich er sich selbst in erster Linie als Poet begreift.
Der erste Gedichtband erschien bereits 1956 (De doden zoeken een huis. Gedichten), weitere im Abstand weniger Jahre. In Deutschland erschien eine erste Auswahl 1964 (Organon-Poesie, übersetzt von Heinrich G. Schneeweiß). Nooteboom übersetzte auch Gedichte ins Niederländische und schrieb Liedtexte, u. a. für Herman van Veen und Liesbeth List, mit der er eine Zeit lang zusammenlebte.
Versuche für das Theater zu schreiben blieben weitgehend erfolglos.
Nooteboom arbeitete u. a. für die niederländische Zeitschrift Elsevier (1957†“60) und die Tageszeitung De Volkskrant (1961†“68). 1967 wurde er Redakteur bei der Zeitschrift Avenue; er war zunächst für das Ressort Reise zuständig, ab 1977 auch für Lyrik.
Als Reporter berichtete er 1956 über den Ungarn-Aufstand, 1963 über den VI. Parteitag der SED und 1968 über die Studentenunruhen in Paris (gesammelt in dem Band Paris, Mai 1968). Ende der 1970er Jahre schrieb er über den Umsturz im Iran und ab November 1989 über den Zusammenbruch der DDR.
Für seine Essay-Sammlung Berlijnse notities (1990; dt.: Berliner Notizen, 1991), die Aufzeichnungen über Berlinbesuche 1961, 1963 und 1989/90 verbindet, erhielt er 1991 den ersten Literaturpreis zum 3. Oktober.
Der Roman Rituelen (1980; dt.: Rituale, 1985) verhalf Nooteboom zu internationaler Bekanntheit. Er erhielt 1982 den Pegasus-Literaturpreis der Mobil Oil Company, der eine englische Übersetzung finanzierte und Übersetzungen in weitere Sprachen nach sich zog. 1989 drehte Herbert Curiel einen Film nach dieser Vorlage. Nach seinem unbeschwerten Erstlingswerk hatte Nooteboom viel über den Prozess des Schreibens und das Verhältnis von Realität und Wirklichkeit in verschiedenen literarischen Gattungen reflektiert, was zu dem im Vergleich zu früheren Werken deutlich distanzierteren und ironischeren Stil von Rituelen beitrug. In der Erzählung Een lied van schijn en wezen (1981; dt.: Ein Lied von Schein und Sein, 1989) und dem kurzen Roman In Nederland (1984, dt.: In den niederländischen Bergen, 1987) machte Nooteboom diese Reflexionen ausdrücklich zum Thema. In beiden Fällen erzählt er sowohl eine Geschichte †“ im Fall von In Nederland eine abgewandelte Form des Kunstmärchens Die Schneekönigin †“ als auch die Geschichte ihres fiktiven Autors, wobei er Probleme des Schreibprozesses und die Stellung des Autors zum Werk thematisiert.
Nootebooms 70. Geburtstag am 31. Juli 2003 war in Deutschland Anlass zu einer näheren Beschäftigung mit Autor und Werk. So erscheint seither im Suhrkamp Verlag eine auf acht Bände angelegte Werksammlung, in der einige Texte zum ersten Mal in deutscher Übersetzung vorliegen.
Der Dokumentarfilm Hotel Nooteboom †“ Eine Bilderreise ins Land der Worte (2003) von Heinz Peter Schwerfel verbindet Interviews mit Nooteboom und einigen seiner Freunde (u. a. Connie Palmen und Rüdiger Safranski) mit Landschaftsaufnahmen und Lesungen aus verschiedenen Büchern des Autors.
Cees Nooteboom lebt heute mit seiner Frau Simone Sassen in Amsterdam und auf Menorca.
Die Novelle Het volgende verhaal (1991; dt.: Die folgende Geschichte) brachte dem Autor nach einer begeisterten Besprechung Marcel Reich-Ranickis den kommerziellen Durchbruch in Deutschland. Auch der Roman Allerzielen (1998; dt.: Allerseelen, 1999) erlangte weltweite Verbreitung, fand jedoch in Deutschland besondere Beachtung, da die Stadt Berlin Schauplatz und ihre Geschichte als geteilte Stadt eins seiner zentralen Motive ist. Inzwischen wird der Autor in Deutschland intensiver rezipiert als in seiner Heimat; es ist bezeichnend, dass die deutsche Ausgabe der Sammlung Nootebooms Hotel (2000) noch vor der niederländischen erschien.
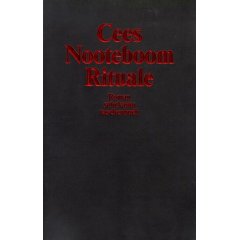 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Cees Nooteboom legt in seinem Erfolgsroman „Rituale“ heiter und melancholisch Zeugnis ab von der weltschaffenden Kraft seines souveränen, leichten wie philosophischen Erzählens, seiner Fähigkeit, das Sein zum Schein und den Schein zum Sein zu verwandeln: Inni Wintrop will sich selbst töten, weil er in seinem Horoskop prophezeit hatte, seine Frau werde mit einem anderen durchbrennen, und er, der ja Löwe war, würde dann Selbstmord begehen. Doch wie der Tod so spielt, der Strick reißt, und Inni Wintrop sieht mit neuer Aufmerksamkeit die Menschen in seiner Stadt Amsterdam.