Terry ist der Pfahl in meinem Fleisch.
Wie Barney es sieht von Mordecai Richler
 Mordecai Richler, geboren am 27. Januar 1931 in Montreal, gestorben am 3. Juli 2001 in Montreal, war ein kanadischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Essayist.
Mordecai Richler, geboren am 27. Januar 1931 in Montreal, gestorben am 3. Juli 2001 in Montreal, war ein kanadischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Essayist.
Zu Lebzeiten gehörte er zu den bekanntesten kanadischen Schriftstellern weltweit. In Kanada selbst war er darüber hinaus durch seine Äußerungen zur kanadischen Politik eine nicht unumstrittene Figur des öffentlichen Lebens. Richler stamme aus einer jüdischen Familie und war Sohn eines Schrotthändlers. Die Nachbarschaft, in welcher er in Montreal aufwuchs, verewigte er später in mehrerern seiner Romane. Er begann ein Englisch-Studium an der Sir George Williams University (jetzt Concordia University), exmatrikulierte sich jedoch, bevor er einen Abschluss erlangt hatte. Im Alter von 19 Jahren zog Richler nach Paris, wo er einige Jahre lebte, bevor er nach London zog. 1972 kehrte er nach Montreal zurück, verbrachte jedoch weiterhin regelmäßig die Wintermonate in London.
Richler gelang mit seinem vierten, 1959 erschienenen, Roman The Apprenticeship of Duddy Kravitz (unter dem Titel Die Lehrjahre des Duddy Kravitz erst im Februar 2007 erstmals in deutscher Übersetzung erschienen) der Durchbruch als Schriftsteller. Wie auch viele seiner folgenden Romane behandelte dieses Buch das Leben der jüdischen Gemeinschaft in der Gegend, in der Richler selbst in den 1940er- und 1950er-Jahren aufgewachsen war. The Apprenticeship of Duddy Kravitz wurde 1974 von Ted Kotcheff verfilmt; das Drehbuch stammte von Richler und Lionel Chetwynd und der Film verhalf Richard Dreyfuss zu seiner ersten Hauptrolle.
Die deutschen Übersetzungen einiger Richler-Romane (u.a. Der Traum des Jakob Hersch, Originaltitel St. Urbain’s Horseman) sind inzwischen vergriffen und erzielen auf dem Gebrauchtmarkt selbst als Taschenbuch Preise bis zu 90€.
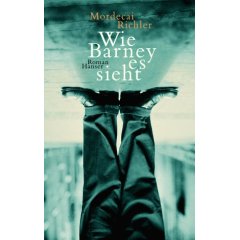 Wie Barney es sieht
Wie Barney es sieht
Auf dem Buchrücken steht:
Mordecai Richler, einer der bedeutendsten kanadischen Erzähler, hat mit diesen Erinnerungen eines vergeßlichen alten Schwadroneurs, Suffkopps und Witzbolds einen hinreißenden Schelmenroman geschrieben.
Ganz im Gegensatz zu landläufigen Meinungen kommen die unterhaltsamsten, witzigsten Bücher dieser Tage eher selten von knackigen jungen Frauen sondern vielmehr von schlaffen alten Männern. Zu nennen wären da Philip Roth, Tom Wolfe oder Steve Tesich: allesamt glänzende Satiriker, die nichts und niemanden schonen, die aber nicht mehr posieren, etwas beweisen müssen. Nicht umsonst wohl auch sind alle Genannten englischsprachige Autoren: Sie kommen aus einer Kultur, in der die Gesellschaftssatire eine große Tradition hat, und in der die Verachtung als gesellschaftliche Grundhaltung nicht so ausgeprägt ist wie beispielsweise in Deutschland oder Frankreich.
So besteht ein entscheidender Unterschied zwischen Brett Easton Ellis einerseits, Michel Houellebecq oder Christian Kracht, sogar Stuckrad-Barre andererseits darin, dass bei letztgenannten echte Verachtung, ja Ekel, ausgelebt wird, während dies bei Ellis in satirischer, man muss sogar sagen, anklagender Absicht demonstriert wird.
Radikale Satire fusst auf einer gewissen, wenngleich grummeligen Sympathie für die Menschen und ihre merkwürdigen Verhaltensweisen, und das schliesst die eigene Person ein. Gefragt ist also eine Mischung aus Distanz und Identifikation mit sich selbst und der Gesellschaft, was darauf hinausläuft, dass dem Gesellschaftssatiriker nichts peinlich sein darf.
Und peinlich ist Barney, der in Mordecai Richlers Buch im Angesicht drohenden Alzheimers seine Lebensbeichte ablegt, nun wirklich kaum etwas. Nicht seine äusserst kleinbürgerliche Herkunft aus dem jüdischen Einwanderer Milieu in Montreal, nicht seine mangelnde schulische Ausbildung. Auch seine Stellung als Mitläufer im Pariser Künstlermilieu der 50iger Jahre verschweigt Barney nicht, ebenso wenig wie Tatsache, dass er später zu Wohlstand kommt durch die Produktion von grauenhaft schlechten Fernsehserien. Nicht mal mit seinen zunehmenden Problemen mit Gedächtnis oder Blase hält er hinterm Berg.
Dabei ist Barney ein Aufschneider, er flunkert, er weicht aus, schweift ab, wo es nur geht oder eben auch nicht geht, er schmückt sich mit fremden Federn, er schmäht, beleidigt, fälscht, was das Zeug hält. Und er ist grenzenlos sentimental, denn nach zwei gescheiterten Ehen hat ihn auch Miriam, Frau seines Lebens, mit der er drei Kinder hat, verlassen.
Mordecai Richler, geb. 1931 in Montreal, gilt in Kanada längst als einer der ganz Großen. In Deutschland hat er den Durchbruch noch nicht geschafft. Sein letzter Roman, „Solomon Gursky“, wurde nur mässig beachtet. Auch diesem Buch wird wohl der ganz grosse Erfolg verwehrt bleiben.
Das, was man in Deutschland gemeinhin mit Kanada verbindet, findet bei Richler kaum statt. Er ist ein Großstädter, fast schon ein Kosmopolit. Wie sein Held Barney verbrachte Richler einige Jahre in Paris und überwintert heute regelmässig in London. Das weite Land, das Leben in der rauhen Natur taugt in diesem Roman nur als Hintergrund für eine ziemlich grimmige Pointe zu der Frage, die Barney ununterbrochen beschäftigt: Ist er ein Mörder? Hat er seinen besten Freund umgebracht, wie die meisten Menschen glauben?
Barney selbst kann diese Frage nicht mehr klären, sowenig, wie er seinen Lebensbericht vollenden kann: Er verfällt vorher der Alzheimerschen Krankheit, sein Gedächtnis, mit dem er schon den Bericht hindurch zu kämpfen hat, verlässt in vollends. Mit einem Nachwort und vielen Korrekturen in Fussnoten versehen ist der Bericht von seinem Sohn. Diese Korrekturen allerdings beziehen sich immer nur auf nachprüfbare Fakten und Daten. Das Skelett der Geschichte, die Geschichten seines Lebens hingegen lassen sich weder veri- noch falsifizieren. Ihr Wahrheitsgehalt steht und fällt mit den Gedächtnissen der daran Beteiligten.
Man kann in diesem Buch durchaus einen modernen Roman sehen, in dem Sinne, dass er das Wesen des Erzählens und des Erinnerns selbst reflektiert. Man kann dem Autor auch eine tiefe melancholische Altersweisheit unterjubeln. In erster Linie aber ist diese Buch erstklassige Unterhaltung, die weder an satirischen Ausfällen in alle erdenklichen Richtungen spart noch sich vor offenem Slapstick scheut. Vorbilder und Referenzen nennt das Werk gleich selbst, allen voran – und hierin ebenso grossmäulig wie sein Protege – Boswells Life of Samuel Johnson.
Ah ja. Klingt wie ein Auszug aus dem „Wachturm“.
😆 ist es bestimmt nicht, das Buch gehört zu meinen Lieblingsbüchern und das würde ich dir gerne auf deinen Stapel legen.
Soso. Mach doch, dann weiß ich wenigstens Bescheid. Was macht es schon, wenn ich dann von meinem Stapel begraben werde.
Hm, mit diesem Hinweis allein werde ich jedenfalls der Lösung nicht wesentlich näher kommen. Pfähle im Fleisch sind eine literarisch relativ häufige Erscheinung.
ok, also, der Autor ist Amerikaner im Sinne von Dons Erklärungen, also KEIN Ami! Geboren in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und im 21. verstorben. Seine Romane sind z.T. nicht mehr im Handel und werden auf dem Schwarzmarkt mit gigantischen Preisen gehandelt (sagen wir mal bis zu 100 Euro das Stück 🙂
Ja, Preisangaben sind ja ein sehr reeller Hinweis, auch wenn sie mich noch schneller erschlagen als mein Bücherstapel. Und diese Preislage möchtest Du mir also anempfehlen?
Nun gut, noch interessanter dürfte recherchemäßig das Todesjahr sein.
Aber ich schätze, in dieser Sache wird Don F., wie meistens, schneller als ich sein.
Ich geh erstmal darüber schlafen und das Preislevel verdauen.
🙂 Guts Nächtle, Ihr beiden!
Schlaft schön!
Und nein, natürlich würde ich dir eines empfehlen, das du zu normalen Preisen kaufen kannst, dass ein Teil seiner Werke und dann auch noch als Taschenbuchausgaben auf dem „Schwarzmarkt“ gehandelt werden, wusste ich bis gerade eben auch noch nicht.
Mit mir ist das wie mit den Operndiven, die auf der Bühne laut singend über eine halbe Stunde lang ausgiebig sterben – egal, ich wollte jedenfalls nochmal schnell zum Besten geben, daß ich momentan auf Jorge Amado tippe (wegen der Preise), ohne aber ein Buch zu wissen, das überlasse ich Don F., weil ich mangels Buch nicht drauf kommen kann, so wenig wie bei Scholl-Latour.
Und nun bin ich endgültig tot respektive unter den Tisch gefallen.
Jetzt wollte ich mich mal zurückhalten †“ und was lese ich beim abschließenden Lesekreis-Check, und das bereits zum 2. Mal in Folge? Den Autor meiner Wahl!
Also ziehe ich mich heute mal grummelnd in meinen Schmollwinkel zurück… 😥
Na dann kommt mal wieder raus aus euren Schmollwinkeln, guten Morgen allerseits und einen schönen 1. Advent, meine Lieben!
Also, mein Autor war, als er noch gelebt hat, der bekannteste Autor seines Landes, er hat sein Studium abgebrochen und einige Jahre in Europa gelebt 🙂
Hall, Dolcevita! Dir auch einen schönen 1. Adventssonntag!
Sind wir denn überhaupt in Lateinamerika richtig?
*nmsf*
Dann würden mir nämlich noch Namen wie Nestor Ibarra, Francisco Coloane, Arturo Alape oder Augusto Roa Bastos einfallen… 😉
… und ein „o“ nachreich…
Hallo mein lieber Don, nein in Lateinamerika seid ihr völlig falsch 😉 und die Namen deiner Kandidaten passen dementsprechend natürlich nicht!
Meine Grafikkarte hat sich eben verabschiedet, deshalb wird die Moderation sehr eingeschränkt sein. Ich werde versuchen von einem PC zum anderen hier im Haus zu huschen, aber ich denke heute am Abend wird es schwierig. Mal sehen, auf jeden Fall bis später…LG
🙂 Guten Tag, Ihr beiden, ich hoffe, es leuchtet Euch schon die erste Kerze, dunkel genug ist es ja.
Hm, wenn es nicht Lateinamerika ist, dann bleibt ja höchstens Kanada übrig.
Dann kann es ja eigentlich nur der Arthur Hailey sein… 😉
Ich würde stattdessen auf Timothy Findley setzen. Der hat den Vorzug, von Geburt an Kanadier zu sein und auch so etwas wie ein Studium begonnen, aber anscheinend auch abgebrochen zu haben.
Schönen Adventssonntagsnachmittag, Anjelka!
Den Findley hab ich auch noch auf meiner Liste, aber den müsste ich wie den Dudek und den Fackenheim noch checken. Habe aber jetzt keine Zeit, ich kann auch erst heute Abend wieder vorbeischauen.
Also, bis dann – und viel Erfolg!
Nope, bis jetzt habt ihr ihn noch nicht gefunden, obwohl ihr mittlerweile im richtigen Land sucht!
Anjelka, klar brennen hier diverse Kerzen und Kipferl habe ich heute auch schon gebacken, bis später, LG
Ich weiß leider nur noch nicht, welches Buch vom Mordecai Richler genau gesucht wird… ;-),
Vielleicht „Der Traum des Jakob Hersch“?
Dann vielleicht „Wie Barney es sieht“?
… oder „Solomon Gursky war hier“?
Na gut, „Die Lehrjahre des Duddy Kravitz“ biete ich noch an, dann muss ich erst mal wieder weg…
Brav so, Mr. Mengsel. Richler dürfte jedenfalls stimmen, und die Preise für seine Bücher stimmen auch. Bei solchen Preisen kann niemand erwarten, daß man zur Klarstellung erst eins der Bücher käuflich erwirbt.
Mein Glückwunsch ist Dir also sicher.
@ dolcevita
Am ersten Advent hat genau 1 Lichtlein zu brennen, in Worten: EIN! Daher erster Advent. DIVERSE Lichtlein brennen dann am Heiligabend – daher „Am Weihnachtsbaume die(verse) Lichtlein brennen“.
Ich hab heute Engelsaugen gebacken und verabschiede mich schon mal wegen Reisevorbereitungen in die innere Emigration.
Liebe dolcevita, leider bin ich ein wenig zu spät, aber es freut mich zu lesen, daß ein von mir vorgeschlagenes Buch des Lesekreises zu deinen Lieblingsbüchern gehört.
Hallihallo und täterätä für Don Farrago und ein frisch gebackenes Kipferl für den Blattschuss.
Er ist von Mordecai Richler aus Wie Barney es sieht
Auf dem Buchrücken steht:
Mordecai Richler, einer der bedeutendsten kanadischen Erzähler, hat mit diesen Erinnerungen eines vergeßlichen alten Schwadroneurs, Suffkopps und Witzbolds einen hinreißenden Schelmenroman geschrieben. Und das kann ich total unterstreichen und ihn euch, falls ihr noch nix von ihm gelesen habt, unbedingt ans Herz oder auch auf den Bücherstapel legen.
@Anjelka, klar nur eine Kerze, aber dafür in jedem Raum 😉
Wann fährst du denn, schon morgen?
Mistikacki, mir fehlt mein Notebook 🙁
LG
jo, Mamalinde, warum auch nicht 🙂 Hast du das nicht gewusst?
Nö, aber nach dem Genuß der jetzigen Schwarte und den Worten eines genialen Erzählers hätte es mir eigentlich klar sein müssen. War ja Dein Vorschlag, danke!
Nö, war eigentlich Dons Vorschlag 😉
@ Dolcevita:
Danke für das Kipferl!
Ich habe eine schöne Rezension
zu dem Buch gelesen, und die macht, zusammen mit deiner Empfehlung, wirklich Appetit auf mehr! Werde ich mir also mal vormerken.
Wie? Der liest doch gar nicht mit im Lesekreis, oder?
P.S. Daß keine Mißverständnisse aufkommen, das Buch gefällt mir, hat ein paar Tausend Worte zu viel, aber 1001 Nacht ist ja ein Dreck dagegen.
Ja, würde mich auch mal interessieren, inwiefern ich das Buch vorgeschlagen habe? Ich kannte es ja vorher gar nicht!
Aber Dolcevita meinte sicher, dass es ein Lösungsvorschlag von mir war.
Nein, ich glaube nicht, dass Don mitliest, zumal er bislang auch leider erfolglos von seinen diversen Großwildsafaris zurückgekehrt ist. Don ist lediglich ein Fan von Boyle, bzw. von Der Wassermusik, und es freut mich außerordentlich zu hören, dass es dir ebenfalls gefällt. Du musst übrigens unbedingt für „Die Mittagsfrau“ am Freitag stimmen, gell 😉 oder hast du etwas in petto? LG
Beim neuen Lesekreisbuch ist mir wichtig, daß es etwas weniger Wörter hat (Puh, 711 eloquent vorgetragene Seiten schaffe ich nicht noch einmal in einer Woche). Ich werde „Barbal, Wie ein Stein im Geröll“ vorstellen, aber Mittagsfrau ist auch interessant.
aha, und was ist „Barbal, Wie ein Stein im Geröll“? Schaue ich mir an..
Ja, die Mittagsfrau gefällt mir immer besser!
@Don, hast du denn die „Wassermusik“ gar nicht gelesen?
Na klar hab ich den Boyle gelesen und genossen! Ich dachte, deine Bemerkung mit dem (eigentlich von mir stammenden) Vorschlag hätte sich auf das gesuchte Richler-Buch bezogen…
Sorry, war etwas unglücklich formuliert. Die Wassermusik hast du ja auch nicht vorgeschlagen, aber wesentlich gepusht. Allerdings habe ich nicht damit gerechnet, dass es sich bei der Abstimmung im Lesekreis durchsetzt. Bin total auf die Besprechung gespannt.
So, hier kommt schon mal mein neuer ES †“ und ich persönlich finde ihn wirklich wunderschön:
„Düdellüdellüt … düdellüdellüt … düdellüdellüt …“
Die Anführungsstriche und die Pünktchen stehen auch im Satz selbst!
Der gesuchte Roman entstand im 4. Quartal des 20. Jahrhunderts, und geschrieben wurde er, wie der erste Satz schon vermuten lässt, von einer (europäischen) Dame, die in der Blüte ihrer Jahre ihre Pressekarriere an den Nagel hängte, um nur noch Hausfrau und Mutter zu sein. Anscheinend war sie aber damit nicht ausgelastet, denn danach hat sie einige erfolgreiche Romane geschrieben, die man grob in das Genre Unterhaltungsliteratur einordnen könnte.
Weitere Moderation gibt’s dann morgen! Viel Spaß!
@Lieber Don, ist es eine englischsprechende „Dame“? Und der Ausdruck „Blüte ihrer Jahre“ stammt von Dir? Und nebenbei gefragt, was bedeutet „nur noch Hausfrau und Mutter“? Unterpriviligiert und minderwertig in der Auswahl ihrer Kriterien?
@ Mamalinde:
Eigentlich wollte ich ja erst morgen im Laufe des Tages weitere Angaben machen, aber da du so lieb fragst:
Der Ausdruck mit der Blüte stammt von mir, aber es trifft zu: Im Alter von Anfang Vierzig hat sie bewusst ihren Job aufgegeben, um sich ihrem Mann, dem Heim und den (zu der Zeit noch geplanten) Kindern zu widmen. Ist also alles nicht abwertend gemeint!
Und zum Bücherschreiben ist sie gekommen wie die Mutter zum Kind †“ und auch sie selbst hat es zu mehreren Kindern gebracht.
Über die Nationalität möchte ich aber vorerst noch nichts sagen… 😉
ok, er ist angerichtet, vielen Dank, lieber Don, für den neuen ES – bin ja gespannt wer dabei heraus kommt 🙂
In Vertretung von Anjelka: Gutes Nächtle…