Treffpunkt: 29.09.07 um 21 Uhr bei Gabriele
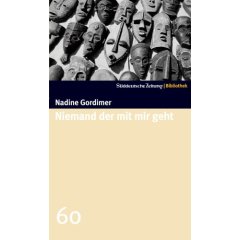 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Nadine Gordimers Roman spielt in Südafrika nach Aufhebung der Apartheid. Vera Stark, die Hauptgestalt, engagiert sich als Juristin immer mehr beim Aufbau des neuen Staatswesens. Diese Arbeit für das Allgemeinwohl bringt ihr innere Befriedigung, stärkt ihr Selbstbewusstsein, führt aber gleichzeitig in die Einsamkeit.Nadine Gordimer, 1923 in Transvaal geboren, beschäftigt sich in ihren Erzählungen mit dem Leben in Südafrika unter den Bedingungen der Apartheidpolitik. Bekannt wurde sie durch Romane wie Fremdling unter Fremden, Der Ehrengast, Burgers Tochter, Julys Leute. Im Jahre 1991 erhielt Nadine Gordimer den Nobelpreis für Literatur.
Über die Autorin
Nadine Gordimer wurde am 20. November 1923 in Springs, Provinz Gauteng, Südafrika als Tochter eines jüdischen Juweliers geboren. Sie wurde wegen einer vermeintlichen Herzschwäche zunächst von ihrer Mutter zuhause unterrichtet, besuchte später jedoch eine Klosterschule. Im Alter von neun Jahren begann sie zu schreiben, und mit 14 Jahren erschien ihre erste Kurzgeschichte (Come Again Tomorrow) auf den Kinderseiten der Zeitschrift Forum (Johannesburg). Ihr Studium an der Witwatersrand University brach sie bereits nach einem Jahr wieder ab. Ihre erste Kurzgeschichtensammlung Face to Face veröffentlichte Nadine Gordimer 1949 in Johannesburg. Mit The Lying Days veröffentlichte sie 1953 ihren ersten Roman. Sie reiste viel in Afrika, Europa und den USA, wo sie in den 60er und 70er Jahren auch mehrfach an Universitäten lehrte. Beinahe ihr gesamtes Leben lebte und schrieb sie in einem Südafrika, dass von Apartheid gespalten war. Gordimer gehörte in den 50er Jahren zu einer kleinen Gruppe, die bewusst die damaligen Apartheidgesetze missachtete, um diese zu unterhöhlen. Mit den Massenverhaftungen von 1956 und dem Verbot des African National Congress (1960) wurde dieses Vorgehen vehement unterbunden. Gordimers konsequentes Eintreten für das Recht auf freie Meinungsäußerung brachte ihr mehrfach Publikationsverbote in ihrem Heimatland ein.
In den 60er Jahren wurde die schwarze Widerstandsbewegung radikaler in ihren Methoden, wandte z.B. Industriesabotage an, wie sie im Roman The Late Bourgeois World (1966) beschrieben wird. Gordimer fühlte sich folglich doppelt ausgegrenzt: durch die Weißen aufgrund des Apartheidregimes, durch die Schwarzen wegen ihrer Hautfarbe.
In ihrem Werk zeigt sie, dass Apartheid kein statischer, starrer Begriff ist, sondern etwas das sich ständig weiterentwickelt. Die Realität in ihrem Werk ist nie schwarz-weiß, sondern mit vielen Grautönen durchsetzt. Ihr Werk ist in über dreißig Sprachen übersetzt worden.
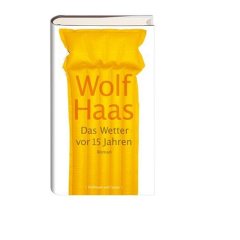 Klappentext:
Klappentext: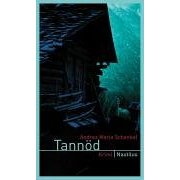 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung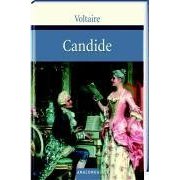 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung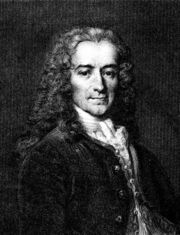 Über den Autor
Über den Autor 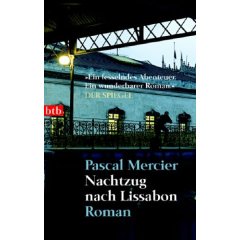 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung