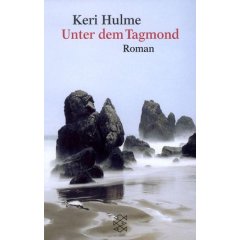Es ist ein Tag im September, und wenn man aus den finstern und gar nicht kühlen Gräbern wieder ans Licht kommt, blinzeln wir, so grell ist der Tag; ich sehe die roten Schollen der Äcker über den Gräbern, fernhin und dunkel das Herbstmeer, Mittag, alles ist Gegenwart, Wind in den staubigen Disteln, ich höre Flötentöne, aber das sind nicht die etruskischen Flöten in den Gräbern, sondern Wind in den Drähten, unter dem rieselnden Schatten einer Olive steht mein Wagen grau von Staub und glühend, Schlangenhitze trotz Wind, aber schon wieder September: aber Gegenwart, und wir sitzen an einem Tisch im Schatten und essen Brot, bis der Fisch geröstet ist, ich greife mit der Hand um die Flasche, prüfend, ob der Wein (Verdicchio) auch kalt sei, Durst, dann Hunger, Leben gefällt mir –
Mein Name sei Gantenbein von Max Frisch
Max Frisch wurde am 15. Mai 1911 in Zürich geboren und starb dort am 4. April 1991. Mit Friedrich Dürrenmatt gehört Frisch zu den wichtigsten schweizerischen Schriftstellern der Nachkriegszeit. Zentrale Themen seines zeitkritischen Werkes sind Selbstentfremdung und das Ringen um Identität in einer ebenso entfremdeten Welt.
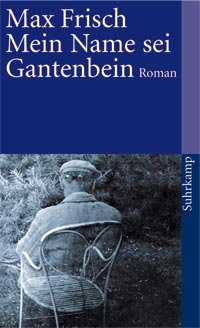 Max Frisch Frisch studierte zuerst in Zürich Architektur und war danach als Journalist und Architekt tätig. Nach ausgedehnten Reisen durch Europa, Amerika und Mexiko war er seit Beginn der fünfziger Jahre als freier Schriftsteller tätig. 1958 erhielt Frisch den Georg-Büchner-Preis, und 1976 wurde er mit dem Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Frischs wohl bekanntestes Stück Andorra (1961) ist eine tragische Parabel auf die Folgen des Antisemitismus, während die Farce Biedermann und die Brandstifter (1958) anhand einer absurden Einquartierungssituation die Anpassungsmentalität des satten Bürgertums und seine Anfälligkeit für autoritäre Herrschaftsformen blosslegt. In seinem zweiten Roman Homo Faber wird aus der Sicht eines rationalistischen Ingenieurs der Gegensatz von technisch-wissenschaftlichem Weltbild und „unlogischen“ Schicksalsmächten geschildert und mit der schon in Stiller auftretenden Eheproblematik (die auch das konfliktgeladene Verhältnis zu seiner langjährigen Lebensgefährtin Ingeborg Bachmann widerspiegelt) verbunden. Frisch entwickelt eine Romanform, indem er permanent verschiedene Textsorten mischt und getroffene Aussagen wieder relativiert. Dieses Mischungsprinzip begegnet wieder in der autobiographischen Erzählung Montauk (1975), die zugleich die Möglichkeiten des Erzählens reflektiert und die Suche nach objektiver Wahrheit als unausweichlichen Fehlschlag auch im eigenen Lebensplan des Autors transparent macht. Seine Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän (1979) ist bereits gezeichnet vom Leiden am Verlust der literarischen Schaffenskraft und an der Aussichtslosigkeit eines Strebens nach einer erfüllten menschlichen Existenz angesichts einer gleichgültigen Natur. Blaubart, seine letzte 1982 veröffentlichte Erzählung, nimmt das Motiv des bekannten Märchens von Charles Perrault auf. Bemerkenswert vom literarischen und argumentativen Standpunkt sind Frischs Tagebücher, erschienen unter dem Titel Tagebuch 1946-1949 (1950) und Tagebuch 1966-1971 (1972). Neben der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur präsentiert sich Frisch hier wie anderenorts als scharfsinniger Kritiker des Zeitgeschehens, insbesondere der Schweizer Verhältnisse. So schockierte er bürgerliche Kreise mit seiner durchaus ernstgemeinten Forderung, die Schweizer Armee ersatzlos abzuschaffen – dies noch lange bevor GSoA ein Begriff war.
Max Frisch Frisch studierte zuerst in Zürich Architektur und war danach als Journalist und Architekt tätig. Nach ausgedehnten Reisen durch Europa, Amerika und Mexiko war er seit Beginn der fünfziger Jahre als freier Schriftsteller tätig. 1958 erhielt Frisch den Georg-Büchner-Preis, und 1976 wurde er mit dem Friedenspreis des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Frischs wohl bekanntestes Stück Andorra (1961) ist eine tragische Parabel auf die Folgen des Antisemitismus, während die Farce Biedermann und die Brandstifter (1958) anhand einer absurden Einquartierungssituation die Anpassungsmentalität des satten Bürgertums und seine Anfälligkeit für autoritäre Herrschaftsformen blosslegt. In seinem zweiten Roman Homo Faber wird aus der Sicht eines rationalistischen Ingenieurs der Gegensatz von technisch-wissenschaftlichem Weltbild und „unlogischen“ Schicksalsmächten geschildert und mit der schon in Stiller auftretenden Eheproblematik (die auch das konfliktgeladene Verhältnis zu seiner langjährigen Lebensgefährtin Ingeborg Bachmann widerspiegelt) verbunden. Frisch entwickelt eine Romanform, indem er permanent verschiedene Textsorten mischt und getroffene Aussagen wieder relativiert. Dieses Mischungsprinzip begegnet wieder in der autobiographischen Erzählung Montauk (1975), die zugleich die Möglichkeiten des Erzählens reflektiert und die Suche nach objektiver Wahrheit als unausweichlichen Fehlschlag auch im eigenen Lebensplan des Autors transparent macht. Seine Erzählung Der Mensch erscheint im Holozän (1979) ist bereits gezeichnet vom Leiden am Verlust der literarischen Schaffenskraft und an der Aussichtslosigkeit eines Strebens nach einer erfüllten menschlichen Existenz angesichts einer gleichgültigen Natur. Blaubart, seine letzte 1982 veröffentlichte Erzählung, nimmt das Motiv des bekannten Märchens von Charles Perrault auf. Bemerkenswert vom literarischen und argumentativen Standpunkt sind Frischs Tagebücher, erschienen unter dem Titel Tagebuch 1946-1949 (1950) und Tagebuch 1966-1971 (1972). Neben der Auseinandersetzung mit der zeitgenössischen Literatur präsentiert sich Frisch hier wie anderenorts als scharfsinniger Kritiker des Zeitgeschehens, insbesondere der Schweizer Verhältnisse. So schockierte er bürgerliche Kreise mit seiner durchaus ernstgemeinten Forderung, die Schweizer Armee ersatzlos abzuschaffen – dies noch lange bevor GSoA ein Begriff war.
Kurzbeschreibung zu Mein Name sei Gantenbein
Max Frisch hat in seinem dritten großen Roman Mein Name sei Gantenbein (1964) sein zentrales Thema, das Problem der Identität, die Spannung des Ichs zum anderen, nicht verlassen. Radikaler erfaßt, entfaltet es sich heiterer, reicher als bisher. Der Komplexität des Themas entspricht die Form. Der Roman spiegelt die Verschiebung von Realität und Phantasie im Bannkreis einer Situation, die die erprobte Rolle eines Menschen in Frage stellt, sein Ich freilegt. Die Geschichten des Buches sind nicht Geschichten im üblichen Sinn, es sind Geschichten wie Kleider, die man probiert. Es sind Rollen, Lebensrollen, Lebensmuster, die die Wirklichkeit erraten haben.