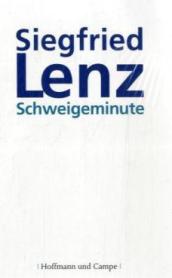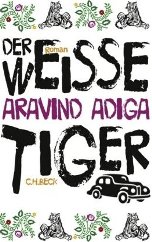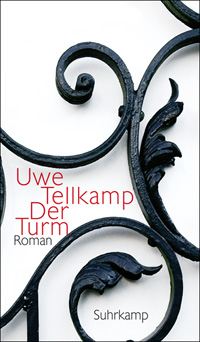Der Deutsche Buchpreis 2008 geht an Uwe Tellkamp für Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land.
Über den Autor
Uwe Tellkamp, geboren am 28. Oktober 1968 in Dresden, ist ein deutscher Arzt und Schriftsteller. Er ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Freiburg im Breisgau.
Einem mit Elmar Krekeler geführten und am 13. August 2004 in der „Welt“ abgedruckten Interview zufolge hat Uwe Tellkamp am 16. Oktober 1985 um 15.30 Uhr seine Berufung zum Schriftsteller entdeckt: An diesem Tag habe er in seinem heimischen Garten die Schönheit roter Rosen entdeckt und den Wunsch verspürt, dieses Bild in Versen auszudrücken. Nach einer Stunde hatte er den Text in Prosa formuliert.
Uwe Tellkamps erster satirischer Text wurde bereits 1987, also zu DDR-Zeiten, im Eulenspiegel veröffentlicht.
Tellkamp verpflichtete sich nach dem Abitur zum dreijährigen Wehrdienst in der NVA. Seine Tätigkeit dort bezeichnet er später als „Panzerkommandant“. Schon vor dem Oktober 1989 wurde Tellkamp wegen „politischer Diversantentätigkeit“ auffällig, da er Texte von West-Autoren und Wolf Biermann bei sich führte. Trotzdem blieb Tellkamp bis zum Oktober 1989 NVA-Unteroffizier. Weil seine Einheit angeblich gegen Oppositionelle, darunter Tellkamps Bruder, ausrücken sollte, habe er den entsprechenden Befehl verweigert. Den Vorgang beschreibt Tellkamp in einem Interview mit der „Frankfurter Rundschau“ folgendermaßen: „Dann ging alles sehr schnell. Da flogen dann die Schulterklappen ab. Dann hieß es: Der Studienplatz für Medizin wird Ihnen entzogen. Und es ging in den Bau.“ Tellkamp sei für zwei Wochen inhaftiert gewesen und danach beurlaubt worden.
Die Tätigkeit als Gehilfe auf einem Braunkohleförderbagger und Hilfsdreher in einem Lichtmaschinenwerk vor dem Oktober 1989 sowie die Arbeit als Hilfspfleger auf einer Intensivstation in Dresden im Jahr 1990 können also keineswegs, anders als es der ORF suggeriert, als unfreiwillige Unterbrechung eines bereits begonnenen Medizinstudiums bewertet werden.
Sein Studium der Medizin absolvierte er danach in Leipzig, New York und Dresden. Nach seinem akademischen Abschluss arbeitete er als Arzt an einer unfallchirurgischen Klinik in München, gab aber den Beruf 2004 zugunsten seiner Schriftstellerkarriere auf, bevor er zunächst nach Karlsruhe und 2007 nach Freiburg umzog. Aus biologischem Hobbyinteresse stellte er Studien zu Farnen an.
Werke
Uwe Tellkamp veröffentlichte zahlreiche Beiträge in Literaturzeitschriften (u.a. Akzente, comma, du, EDIT, entwürfe, Lose Blätter, ndl, Schreibheft und Sprache im technischen Zeitalter) sowie Anthologien. Gelegentlich verfasst er auch Essays für Zeitungen.
Einer breiteren Öffentlichkeit bekannt wurde Tellkamp durch den Vortrag eines Auszugs aus seinem Roman Der Schlaf in den Uhren im Juni 2004 in Klagenfurt, durch den er den Ingeborg-Bachmann-Preis gewann, sowie durch die Folgen dieses Preisgewinns: Dadurch, dass sich 2008 und 2009 alle Abiturienten in Niedersachsen mit diesem Auszug im Fach Deutsch befassen müssen, rückte Tellkamp in den Rang eines Verfassers von Pflicht-Schullektüre auf. Ebenfalls für Aufsehen sorgte 2005 der Roman Der Eisvogel. Im Herbst 2008 ist der Roman Der Turm erschienen. Verlegerin Ulla Unseld-Berkéwicz vom Suhrkamp-Verlag empfiehlt persönlich den „große[n] Wenderoman der jüngeren Generation“ mit den Worten, Uwe Tellkamp arbeite „im Turm die Zeit vom November 1982 bis zum 9. November 1989 auf“. Elmar Krekeler behandelte am 13. September 2008 den Roman als „Buch der Woche“. Für Der Turm erhielt Tellkamp den Deutschen Buchpreis 2008.
Tellkamps Arbeitsstil ist dadurch gekennzeichnet, dass er in unregelmäßigen Abständen Auszüge aus noch unveröffentlichten umfassenden Werken bei Autorenlesungen vorträgt und teilweise auch als Auszüge veröffentlicht. Das trifft insbesondere auf sein Langgedicht in der Tradition Homers mit dem Titel Nautilus zu, aber auch auf die Romane Der Schlaf in den Uhren und Der Turm.
Tomas Gärtner schreibt über Uwe Tellkamps Nautilus-Projekt: „Wahrscheinlich entwickelt es sich zu einem Lebensprojekt.“ Geplant hat er es auf drei Bände. In Band 1, Das Aschenschiff, soll es vor allem um Politik und Geschichte gehen, orientiert an der Höllenreise in Dantes Göttlicher Komödie; Band 2, Falter, hat im Gegensatz dazu das Paradies als motivischen Mittelpunkt; Band 3, Vineta, soll eine Reise durch Dresden, aber auch andere Städte und Stadtstaaten werden, die bis nach Utopia reicht.
Tellkamp selbst beschreibt in der Zeitschrift Bella triste sein literarisches Schaffen mit den Worten: „Der moderne Dichter, wie ich ihn verstehe, ist wie der Dom-Baumeister; er ist damit, wie diejenigen, die sich aufmachten, Kap Hoorn zu umsegeln oder einen Seeweg nach Indien zu finden, zwangsläufig pathetisch †“ was er in Kauf nehmen kann, wenn es ihm gelingt, die grundlegenden menschlichen Empfindungen wieder zu gestalten.“
In einem Interview mit dem „Oberpfalznetz“ charakterisiert Tellkamp sein Schreiben als einen „Versuch, Heimat wiederzugewinnen†œ, die durch den Ablauf der Zeit verloren gegangen sei. Damit stellt sich Tellkamp in die Tradition von Marcel Proust (Auf der Suche nach der verlorenen Zeit)
Uwe Tellkamps erster veröffentlichter Roman, Der Hecht, die Träume und das Portugiesische Café (2000) stieß im Publikum nur auf geringes Interesse und wurde nicht neu aufgelegt.
Für einen Auszug aus dem noch unvollendeten Roman Der Schlaf in den Uhren erhielt Tellkamp 2004 den Bachmann-Preis. Die Jury zeigte sich begeistert von diesem Auszug. Die zahlreichen Feuilleton-Artikel vom 28. Juni 2004 über die Preisverleihung zeigen ein uneinheitliches Bild, ebenso die später verfassten Rezensionen. Gelobt wurde vor allem die virtuose Sprachbeherrschung Tellkamps, kritisiert wurde hingegen, dass der Text schwer verständlich sei und dass der Auftritt Tellkamps in Klagenfurt auf die Mentalität der Jury zugeschnitten gewesen sei.
Tellkamps 2005 veröffentlichter Roman Der Eisvogel polarisierte das Feuilleton. Volker Weidermann warf ihm z.B. in einem Neues Deutschland betitelten Feuilletonbeitrag in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 10. April 2005 vor, er zeige in seinem Roman nicht genügend Distanz zu den Protagonisten, die für eine Konservative Revolution eintreten und die Demokratie ablehnen. Ijoma Mangold von der Süddeutschen Zeitung dagegen hält den Eisvogel für einen gelungen „politischen Zeitroman“, der das Thema Terrorismus aufgreift. Auf die Frage, ob er ein „rechter Schriftsteller“ sei, antwortet Uwe Tellkamp in einem Interview mit Daniela Weiland lapidar mit: „Nein. Mit wenigen Ausnahmen, finde ich, hat die Kritik vor dem Buch versagt“, beschwerte sich Tellkamp anschließend bei Daniela Weiland.
Elmar Krekeler meint zu Tellkamps politischer Haltung: „Er ist immunisiert gegen Ostalgie und frei von überflüssiger Euphorie über das wiedervereinigte Deutschland“. Krekeler bescheinigt dem Autor einen Hang zur „Hermetik†œ, d.h. zu Aussagen, die nicht gänzlich dechiffriert werden können. Diesen Hang erklärt Krekeler durch einen doppelten Ausschluss Tellkamps von der ihn umgebenden Welt: erstens die zwangsweise Trennung des DDR-Bürgers durch Mauer und Stacheldraht vom Westen und zweitens die freiwillige Absonderung des Angehörigen des Bildungsbürgertums, das in Ostdeutschland auf eine im Westen oft als „museal†œ empfundene Weise erhalten geblieben sei, von der Gesellschaft der DDR. Dadurch stehe Tellkamp seinen Kollegen im ehemaligen Ostblock geistig näher als seinen deutschsprachigen Kollegen in den alten Bundesländern, in Österreich und der Schweiz.
Der Turm. Geschichte aus einem versunkenen Land
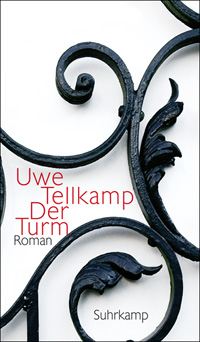 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Hausmusik, Lektüre, intellektueller Austausch: Das Dresdner Villenviertel, vom real existierenden Sozialismus längst mit Verfallsgrau überzogen, schottet sich ab. Resigniert, aber humorvoll kommentiert man den Niedergang eines Gesellschaftssystems, in dem Bildungsbürger eigentlich nicht vorgesehen sind. Anne und Richard Hoffmann, sie Krankenschwester, er Chirurg, stehen im Konflikt zwischen Anpassung und Aufbegehren: Kann man den Zumutungen des Systems in der Nische, der „süßen Krankheit Gestern“ der Dresdner Nostalgie entfliehen wie Richards Cousin Niklas Tietze – oder ist der Zeitpunkt gekommen, die Ausreise zu wählen? Christian, ihr ältester Sohn, der Medizin studieren will, bekommt die Härte des Systems in der NVA zu spüren. Sein Weg scheint als Strafgefangener am Ofen eines Chemiewerks zu enden. Sein Onkel Meno Rohde steht zwischen den Welten: Als Kind der „roten Aristokratie“ im Moskauer Exil hat er Zugang zum seltsamen Bezirk „Ostrom“, wo die Nomenklatura residiert, die Lebensläufe der Menschen verwaltet werden und deutsches demokratisches Recht gesprochen wird.
In epischer Sprache, in eingehend-liebevollen wie dramatischen Szenen entwirft Uwe Tellkamp ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben, der den Turm mit sich reißen wird.
Quelle: Wikipedia