„Vielleicht ist es sein schönstes Buch.“ – Marcel Reich-Ranicki, F.A.Z.
„Selten las man etwas so Keusches, etwas so Erotisches.“ – Ulrich Greiner, Die Zeit
„Ein wunderschönes Liebesbuch, wie es schon lange keines mehr gab.“ – Volker Weidermann, F.A.S.
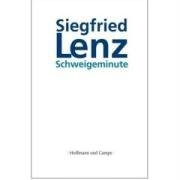 Leseprobe aus Schweigeminute von Siegfried Lenz
Leseprobe aus Schweigeminute von Siegfried Lenz
„Wir setzen uns mit Tränen nieder“, sang unser Schülerchor zu Beginn der Gedenkstunde, dann ging Herr Block, unser Direktor, zum bekränzten Podium. Er ging langsam, warf kaum einen Blick in die vollbesetzte Aula; vor Stellas Photo, das auf einem hölzernen Gestell vor dem Podium stand, verhielt er, straffte sich, oder schien sich zu straffen, und verbeugte sich tief. Wie lange er in dieser Stellung verharrte, vor deinem Photo,Stella,über das ein geripptes schwarzes Band schräg hinlief, ein Trauerband, ein Gedenkband; während er sich verbeugte, suchte ich dein Gesicht, auf dem das gleiche nachsichtige Lächeln lag, das wir, die ältesten Schüler, aus deiner Englischstunde kannten. Dein kurzes schwarzes Haar, das ich gestreichelt, deine hellen Augen, die ich geküßt habe auf dem Strand der Vogelinsel: Ich mußte daran denken, und ich dachte daran, wie du mich ermuntert hast, dein Alter zu erraten. Herr Block sprach zu deinem Photo hinab, er nannte dich liebe, verehrte Stella Petersen, er erwähnte, daß du fünf Jahre zum Lehrerkollegium des Lessing-Gymnasiums gehörtest, von den Kollegen geschätzt, bei den Schülern beliebt. Herr Block vergaß auch nicht, deine verdienstvolle Tätigkeit in der Schulbuchkommission zu erwähnen, und schließlich fiel ihm ein, daß du ein allzeit fröhlicher Mensch gewesen warst: „Wer ihre Schulausflüge mitmachte, schwärmte noch lange von ihren Einfällen, von der Stimmung, die alle Schüler beherrschte, dies Gemeinschaftsgefühl, Lessingianer zu sein; das hat sie gestiftet, dies Gemeinschaftsgefühl.“ […] mehr von der Leseprobe beim Verlag Hoffmann und Campe
Kurzbeschreibung
Stella Petersen war zweifellos eine der beliebtesten Lehrerinnen am Lessing-Gymnasium. Ihre Lebensfreude, ihre Intelligenz und Belesenheit verschafften ihr die Anerkennung und den natürlichen Respekt des Kollegiums wie den ihrer Schüler. Und gewiss führte die Liebe zu ihrem Schüler Christian, die über das ungleiche Paar am Ende der Sommerferien hereinbrach, zu jener Verwirrung der Gefühle deren Intensität und Kraft beide überwältigt. Siegfried Lenz hat eine großartige Novelle geschrieben über die Liebe eines Gymnasiasten zu seiner Englischlehrerin, eine Geschichte über das Erwachsenwerden und das Erwachsensein, eine Geschichte, in der unbeschreibliches Glück neben tief empfundener Trauer steht.
Über den Autor
Siegfried Lenz, geboren am 17. März 1926 in Lyck, Ostpreußen, als Sohn eines Zollbeamten, ist ein deutscher Schriftsteller und einer der bekanntesten deutschsprachigen Erzähler der Nachkriegs- und Gegenwartsliteratur.
Nach dem frühen Tod des Vaters zog seine Mutter, samt Tochter von Lyck weg und ließ den gerade schulpflichtig gewordenen Siegfried bei der Großmutter zurück. Nach dem Notabitur 1943 wurde er zur Marine eingezogen.
Nach Unterlagen des Berliner Bundesarchivs ist Lenz in der Zentralkartei der NSDAP mit dem Beitrittsdatum 12. Juli 1943 verzeichnet.[1]. Lenz will davon nichts gewusst haben und geht davon aus, dass er ohne sein Wissen in einem Sammelverfahren in die NSDAP aufgenommen wurde.
Kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs desertierte er in Dänemark und geriet auf seiner Flucht in Schleswig-Holstein in britische Kriegsgefangenschaft. Dort wird Lenz zum Dolmetscher einer britischen Entlassungskommission.
Nach seiner Entlassung besuchte er die Universität Hamburg, um dort Philosophie, Anglistik und Literaturwissenschaft zu studieren. Sein Studium brach er allerdings vorzeitig ab und wurde Volontär bei der Tageszeitung Die Welt und von 1950 bis 1951 Redakteur dieser Zeitung. Dort lernte er auch seine zukünftige Ehefrau Liselotte († 5. Februar 2006) kennen. Die Ehe wurde 1949 geschlossen.
1951 unternahm Siegfried Lenz eine von dem Honorar für seinen ersten Roman (Es waren Habichte in der Luft) finanzierte Afrikareise nach Kenia. Über das, was er in dieser Zeit erlebte, unter anderem den Mau-Mau-Aufstand, schreibt er in seiner Geschichte Lukas, sanftmütiger Knecht.
Siegfried Lenz lebt seit 1951 als freier Schriftsteller in Hamburg und war Mitglied des Literaturforums „Gruppe 47†œ. Gemeinsam mit Günter Grass engagierte er sich für die SPD und unterstützte die Ostpolitik Willy Brandts. Zur Unterzeichnung des deutsch-polnischen Vertrages wurde er 1970 sogar nach Warschau eingeladen.
Siegfried Lenz ist seit 2003 Gastprofessor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität.
Scheigeminute von Siegfried Lenz – Gebundene Ausgabe: 128 Seiten, Verlag: Hoffmann und Campe (5. Mai 2008)
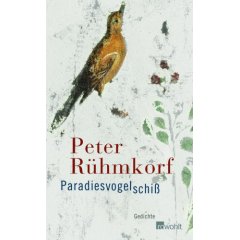 Rückblickend mein eigenes Leben
Rückblickend mein eigenes Leben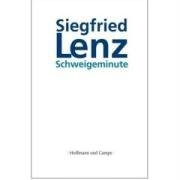


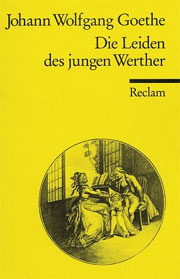

 „Niemand hielt es auf, niemand schaute hin, niemand stellte Fragen.†œ
„Niemand hielt es auf, niemand schaute hin, niemand stellte Fragen.†œ