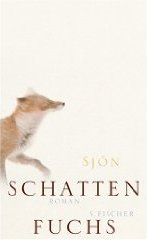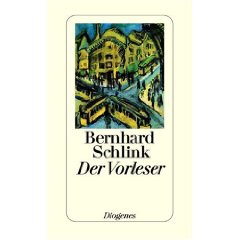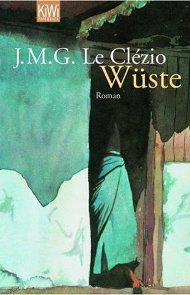Nachdem Virginia Woolf schon im Mai im Gespräch war und die Abstimmung im Lesekreis nur ganz knapp für den „Schattenfuchs von Sjón“ ausfiel, befassen wir uns jetzt fast einstimmig am 03. Juli zur gewohnten Zeit mit Virginia Woolfs Mrs Dalloway. Wir treffen uns, bei hoffentlich schönem Wetter, unter dem Freisitz bei Gerlinde und Rainer.
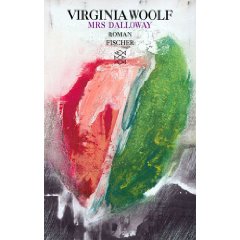 Buch der 1000 Bücher
Buch der 1000 Bücher
Copyright: Aus Das Buch der 1000 Bücher (Harenberg Verlag)
Mit dem Roman Mrs. Dalloway erweiterte Virginia Woolf die realistische Erzählweise des 19. Jahrhunderts um die experimentelle Form der Stream of consciousness-Technik (R Stichwort S. 1169). In der Überzeugung, jedes Individuum erfahre und verarbeite die objektive Realität unterschiedlich und schaffe sich im Bewusstsein eine eigene Wirklichkeit, schildert die Autorin Sinneseindrücke und Gedankenströme der Romanfiguren. Die Wiedergabe von Vorgängen in der äußeren Welt ist von untergeordneter Bedeutung. Woolf sah ihre Aufgabe darin, in die Psyche der Figuren vorzudringen, um die Dualität von Welt und Mensch zu verdeutlichen, und schuf mit Mrs. Dalloway den Prototyp des Bewusstseinsromans.
Inhalt:
Die Handlung des Romans konzentriert sich auf den Ablauf eines Tages. An einem Londoner Junitag 1923 trifft die 52-jährige Hauptfigur Clarissa Dalloway Vorbereitungen für eine Abendgesellschaft, die sie mit ihrem Ehemann Richard in ihrem Haus gibt. Nach ein paar Besorgungen in der Stadt bekommt sie Besuch von ihrem Jugendfreund Peter Walsh. Später bereitet sie sich für den Abend vor, an dem sie die perfekte Gastgeberin ist.
 Parallel zu dem Geschehen um Clarissa führt Virginia Woolf die Figur des nervenkranken Kriegsveteranen Septimus Warren Smith ein, dessen psychische Instabilität als Folge seiner Erlebnisse während des Ersten Weltkriegs am Ende des Romans zu seinem Selbstmord führt.
Parallel zu dem Geschehen um Clarissa führt Virginia Woolf die Figur des nervenkranken Kriegsveteranen Septimus Warren Smith ein, dessen psychische Instabilität als Folge seiner Erlebnisse während des Ersten Weltkriegs am Ende des Romans zu seinem Selbstmord führt.
Aufbau: Woolf arbeitet in die äußere Romanhandlung ein inneres Geschehen ein. Dabei kontrastiert sie beide nebeneinander existierenden Wirklichkeitsebenen: Die innerlich erlebte Zeit der Figuren (mind-time) steht der äußeren messbaren Zeit (clock-time) gegenüber, verdeutlicht durch die Glockenschläge von Big Ben. Die Stundenschläge bilden ein wesentliches Strukturelement: Sie fungieren als Übergänge vom Bewusstsein einer Person in das Bewusstsein einer anderen.
Für die Romanfiguren sind die Vorgänge der äußeren Welt Anlässe, in ihre eigene Gedankenwelt und Wirklichkeit einzutauchen und durch Assoziationen vergangene Lebenssituationen wieder zu erleben. Clarissa Dalloway erinnert sich an ihre Jugend und an verpasste Möglichkeiten, hervorgerufen durch das Wiedersehen mit ihrem Jugendfreund. Die Begegnung führt Clarissa darüber hinaus die Erkaltung ihrer aus gesellschaftlichen Zwängen bestehenden Ehe vor Augen. Die Figur weist eine polarisierte Spannung auf. Einerseits versucht sie der Gesellschaft zu entfliehen, andererseits vermitteln flüchtige Momente des Glücks und der Freude in ihr den Wunsch, Teil des Lebens zu sein.
Septimus durchlebt die Vergangenheit, den Krieg, immer wieder aufs Neue. Das Leitmotiv »Fürchte nicht mehr Sonnenglut« aus R Shakespeares dramatischer Romanze Cymbeline (1608) stellt die Verbindung der beiden Protagonisten her. Woolf entwarf die Septimus-Figur als eine Art Doppelgänger zu Clarissa, indem sie das Schicksal beider kontrapunktisch gegenüberstellt. Clarissa erfährt auf ihrer Abendgesellschaft von Septimus†™ Tod. In seinem Schicksal erkennt sie ihr mögliches eigenes. Am Ende des Romans entscheidet sie sich für das Leben.
Wirkung: Die formale Art der Darstellung stellte in den 1920er Jahren ein literarisches Novum dar und wurde mit Ulysses (1922) von James R Joyce, der Woolf künstlerisch beeinflusste, richtungweisend für den Roman der Moderne sowie den Nouveau Roman in Frankreich.
Kurzbeschreibung
An einem Junitag des Jahres 1923 bereitet Clarissa Dalloway, eine der glänzendsten Londoner Gastgeberinnen, eine große Abendgesellschaft vor. Während sie alle konventionellen Erwartungen erfüllt, stellen sich bei ihr Erinnerungen und Assoziationen ein, die ihr nach und nach bewußt machen, wie sehr ihre äußere Existenz sich von ihrer inneren unterscheidet.
Über die Autorin
Virginia Woolf (1882-1941) war, zusammen mit ihrer Schwester Vanessa, Mittelpunkt der „Bloomsbury Group“, des Künstler- und Literatenzirkels, der sich um 1905 in London zusammenfand. Ihr erster Roman, Die Fahrt hinaus, erschien 1915. Neben den Romanen umfaßt ihr Gesamtwerk Erzählungen, Tagebücher, Briefe und eine Vielzahl von Essays. Virginia Woolf gilt als die bedeutendste englische Schriftstellerin dieses Jahrhunderts.
Virginia Woolf litt unter schweren Depressionen. Am 28. März wählte sie im Fluss Ouse bei Lewes in Sussex den Freitod. Da sie sehr gut schwimmen konnte, packte sie einen großen Stein in ihren Mantel, um eine eventuelle Selbstrettung zu verhindern. Ihre Leiche wurde erst nach drei Wochen, am 18. April, gefunden. Sie hinterließ zwei Abschiedsbriefe, einen an ihre Schwester Vanessa und einen an ihren Ehemann. Dieser endet mit den Sätzen:
„Alles, außer der Gewißheit Deiner Güte, hat mich verlassen. Ich kann Dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind.“
Die Werke von Virginia Woolf erscheinen seit 1989 im S.Fischer Verlag in neuen Übersetzungen, herausgegeben und annotiert von Klaus Reichert, und in der Umschlaggestaltung von Sarah Schumann.