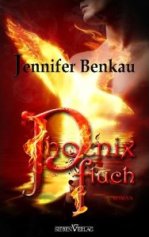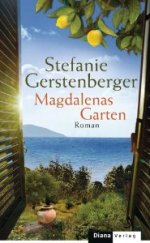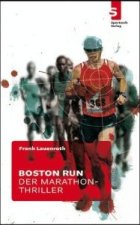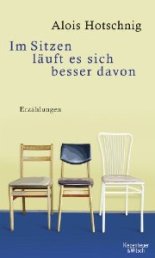Abby Cooper: Detektivin mit 7. Sinn von Victoria Laurie
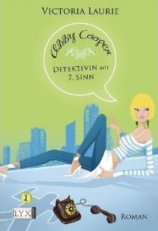 Die 31-jährige Abigail Cooper ist Single und lebt in Royal Oak, einem kleinem Vorstädtchen von Detroit in Michigan. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich als intuitive Beraterin, denn Abby ist ein Medium und anders als andere Menschen. Sie kann gewisse Dinge vorhersehen, indem sie mit ihren „Geistern†œ, die sie liebevoll ihre „Crew†œ nennt, in Verbindung tritt. Als ihre einzige Freundin Theresa, mit der sie sich ihre Praxis teilt, in einen anderen Bundesstaat zieht, versucht sie ihre soziales Leben etwas aufzufrischen und meldet sich bei einer Singlebörse an.
Die 31-jährige Abigail Cooper ist Single und lebt in Royal Oak, einem kleinem Vorstädtchen von Detroit in Michigan. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich als intuitive Beraterin, denn Abby ist ein Medium und anders als andere Menschen. Sie kann gewisse Dinge vorhersehen, indem sie mit ihren „Geistern†œ, die sie liebevoll ihre „Crew†œ nennt, in Verbindung tritt. Als ihre einzige Freundin Theresa, mit der sie sich ihre Praxis teilt, in einen anderen Bundesstaat zieht, versucht sie ihre soziales Leben etwas aufzufrischen und meldet sich bei einer Singlebörse an.
Das erste Date scheint gleich ein Volltreffer zu sein. Dutch ist ein netter Kerl und entspricht genau ihrem Geschmack. Bei diesem Treffen lässt Abby sich dazu verleiten ein paar Dinge über ein vermisstes Kind zu erzählen. Da sie nicht weiß, dass Dutch bei der Polizei arbeitet, ist sie umso überraschter, als er im Rahmen der Ermittlungen plötzlich bei ihr auftaucht. Ihre Vorhersagen waren absolut zutreffend und so konnte das Verbrechen aufgeklärt werden.
Als kurz darauf eine Klientin von ihr ums Leben kommt, gerät Abby in große Gefahr. Denn der Mörder hat eine Kassette gefunden, auf der sie die letzte Sitzung mit der Toten aufgezeichnet hat und darin die Ermordete vor dem Täter warnt. Während der Ermittlungen kreuzen sich die Wege von Abby und Dutch immer wieder. Dabei wollte sie ihm eigentlich aus dem Weg gehen. Dutch ist überzeugter Realist und hat so seine Probleme damit an das Übersinnliche zu glauben. Doch Abbys treffsichere Aussagen bringen ihn immer mehr zum Grübeln. Abby kann sich einfach nicht aus den Ermittlungen heraushalten und gerät zunehmend ins Visier des Mörders.
Dieser Roman bietet eine abwechslungsreiche, kurzweilige und humorvolle Geschichte. Er liest sich sehr flüssig und man hat auch keine Probleme einen Einstieg zu finden. Die Erklärungen der Protagonistin, wie denn ihre Gabe funktioniert, sind glaubwürdig und machen Abby so sympathisch. Es ist unterhaltsam ihr zu folgen und so manches Mal wünscht man sich auch diese Gabe der Intuition zu besitzen. Wäre es nicht schön, wenn man bei jeder schwierigen Entscheidung sich selbst befragen könnte und der eigene Geist die richtige Antwort parat hätte? Oder wenn man auf Anhieb erkennen würde, ob man belogen wird oder nicht? Abby lässt ihr Leben allerdings nicht durch dieses Talent bestimmen, sie kann ihre Gabe auch unterdrücken. Ihre eigenes Empfinden, ihre Empathie und ihre Unsicherheit machen Abby besonders liebenswert, denn natürlich begegnen ihr viele Menschen, die sie als Schwindlerin abstempeln. Sie lässt sich nicht unterkriegen und steht mit beiden Beinen fest auf dem Boden. Die romantischen Anteile halten sich in Grenzen und erotische Szenen sind hier auch nicht zu finden. Dafür ist es umso spannender und man fiebert dem Ende entgegen und hofft für Abby auf ein Happy-End in allen Bereichen. Ich würde dieses Buch auch insbesondere als Urlaubslektüre empfehlen, denn der Inhalt sorgt für ein paar unbeschwerte Stunden voller Lesevergnügen.
Kurzbeschreibung
Als professionelles Medium kommuniziert Abby Cooper mit der Welt der Geister, um ihren Klienten die Zukunft vorherzusagen. Da wird eine ihrer Klientinnen tot aufgefunden, und der gut aussehende Kommissar Dutch stattet Abby einen Besuch ab, um sie zu dem Mordfall zu befragen. Zwischen beiden fliegen augenblicklich die Funken. Das einzige Problem dabei: Dutch glaubt nicht an Übersinnliches. Abby beschließt, auf eigene Faust die Ermittlungen aufzunehmen und gerät dadurch schon bald in höchste Lebensgefahr. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der sie immer wieder mit dem charmanten Dutch zusammenführt …
Über die Autorin
Victoria Laurie lebt in Austin, Texas und arbeitet als professionelles Medium. 2003 hatte sie während der Arbeit die Idee einen Roman über ein Medium namens Abby Cooper zu schreiben, berichtet die Autorin auf ihrer Homepage. Abby Cooper: Detektivin mit 7. Sinn (orig. Titel: Abby Cooper, Psychic Eye) erschien in den USA im Jahr 2004. Die deutschsprachige Übersetzung ist am 06.12.2010 im LYX Verlag erschienen. Der nächste Teil mit Abby Cooper erscheint im Juni 2011 ebenfalls bei LYX unter dem Titel „Mörderische Visionen“. Mittlerweile hat Victoria Laurie 12 Romane veröffentlicht. Neben der Abby-Cooper-Serie hat sie ebenfalls sehr erfolgreich eine Reihe über die sympathische Geisterjägerin M. J. Holliday geschrieben.
Der Lesekreis bedankt sich bei Doc für die schöne Buchbesprechung und beim LYX Verlag für die freundliche Überlassung eines Rezensionsexemplares.
[adsense format=text]