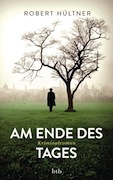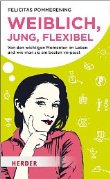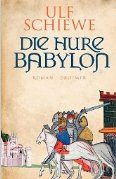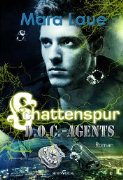 In Savannah, Georgia USA, werden mehrere Menschen scheinbar ohne Grund und unabhängig von einander in Katatonie versetzt. Dies ruft die Special Agents Wayne Scott und Travis Halifax, Mitglieder einer geheimen Sondereinheit des FBI, auf den Plan. Durch ihre außergewöhnlichen Gaben erkennen sie schnell, dass eine besondere Art von Magie im Spiel ist. So treffen sie während ihrer Ermittlungen auf Kianga Renard, deren Großmutter auch dieser seltsamen „Krankheit“ zum Opfer fiel. Gleich bei ihrer ersten Begegnung knistert es gewaltig zwischen Wayne und Kianga. Beide spüren eine seltsame Anziehungskraft, der sie sich nicht entziehen können und wollen. Doch Kianga ist eine der Hauptverdächtigen, denn sie scheint eine besondere Verbindung zu dem skrupellosen Täter zu haben.
In Savannah, Georgia USA, werden mehrere Menschen scheinbar ohne Grund und unabhängig von einander in Katatonie versetzt. Dies ruft die Special Agents Wayne Scott und Travis Halifax, Mitglieder einer geheimen Sondereinheit des FBI, auf den Plan. Durch ihre außergewöhnlichen Gaben erkennen sie schnell, dass eine besondere Art von Magie im Spiel ist. So treffen sie während ihrer Ermittlungen auf Kianga Renard, deren Großmutter auch dieser seltsamen „Krankheit“ zum Opfer fiel. Gleich bei ihrer ersten Begegnung knistert es gewaltig zwischen Wayne und Kianga. Beide spüren eine seltsame Anziehungskraft, der sie sich nicht entziehen können und wollen. Doch Kianga ist eine der Hauptverdächtigen, denn sie scheint eine besondere Verbindung zu dem skrupellosen Täter zu haben.
Wayne Scott ist einigen Lesern schon aus dem 2. Band der Dämonen-Trilogie (Rezension: Dämonenerbe 02 †“ Prophezeiung von Mara Laue) bekannt. Nun erfahren wir endlich mehr über den Mann, der durch seine Gabe des Gedankenlesens von seinen Eltern als Monster bezeichnet und abgelehnt wurde. Geprägt durch Unverständnis und Furcht in seiner Umgebung war es für ihn nicht leicht, mit seiner besonderen Gabe aufzuwachsen. Erst eine Schamanin lehrt ihn, seine Fähigkeiten zu beherrschen und zu nutzen. Waynes beruflichen Erfolge beim FBI täuschen nicht darüber hinweg, dass er im Privatleben ein einsamer Mensch ist. Bis auf seinen Kollegen und Freund Travis meidet er zumeist den näheren Kontakt zu seinen Mitmenschen. Er hatte schon die Hoffnung aufgegeben, jemanden mit der gleichen Gabe oder zumindest eine Partnerin, die sich davon nicht abschrecken lässt, zu finden. In Kianga trifft er nicht nur eine Gleichgesinnte, sondern auch endlich die Frau, mit der er gemeinsam durchs Leben gehen möchte. Alles wäre perfekt, wenn da nicht Zweifel und Misstrauen an ihm nagen würden, ob sie nicht doch mit dem Täter gemeinsame Sache macht.
Einfühlsam und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl meistert Wayne während seiner Ermittlungen die immer noch im tiefen Süden der USA unterschwellig herrschende Problematik zwischen Schwarz und Weiß.
Anders als Wayne wuchs die Tänzerin Kianga in einer Umgebung auf, in der Magie und Okkultismus zum Alltag gehören. Doch sie befindet sich seit Jahren unter falschem Namen auf der Flucht vor dem eisigen Hauch des Bösen aus ihrer Heimat Haiti. Nur ihre Großmutter, mit der sie herzlich verbunden ist, kennt ihre wahre Identität. Anhand der jüngsten Ereignisse muss sie erkennen, dass ihre Vergangenheit sie leider doch eingeholt hat und sie sich ihr stellen muss, um die gefangenen Seelen zu befreien. Wayne, in dem sie einen Partner gefunden hat, der nicht nur ihre Gabe teilt, sondern auch ihr Herz berührt, schwebt in großer Gefahr. Um sein Leben nicht zu gefährden, muss sie sich alleine in die Höhle des Löwen begeben. Äußerste Vorsicht ist geboten, denn ihr Gegner ist sehr machtvoll und versucht, sie mit allen Mitteln an seine dunkle Seite zu ziehen. Trotz der geheimen Kräfte, die in ihr wohnen, ist ihr Widersacher nicht leicht zu besiegen. Ein Kampf um gefangene Seelen, Leben und Tod beginnt…
Versiert spinnt Mara Laue die Fäden weiter aus der Welt, in der mystische Wesen im Verborgenen unter uns leben, und zieht den Leser diesmal in die interessante Welt des Okkultismus und Voodoo. Gekonnt verwischt sie in dieser Geschichte um Macht, Manipulation, Seelenverwandtschaft und Magie die Grenzen zwischen Phantasie und Realität. Mit viel Liebe zum Detail ist dieser sehr gut recherchierte, spannende und mit einer gehörigen Portion Romantik versehene Roman ein wahres Lesevergnügen. Alle Charaktere, auch die weniger sympathischen, sind sehr gut ausgearbeitet. Das Nachwort der Autorin bietet auch dem bisher unkundigen Leser hinreichende Erklärungen und Wissenswertes über den Voodoo Kult.
Mir hat das Buch sehr gut gefallen und da dieser Band der Auftakt zu einer Serie mit den D.O.C. Agents zu sein scheint, bin ich schon auf die folgenden Bände gespannt.
Der Lesekreis bedankt sich ganz herzlich bei Angie für diese schöne Buchbesprechung und beim Sieben Verlag für die freundliche Überlassung eines Rezensionsexemplares.
Kurzbeschreibung
Erscheinungstermin: Februar 2013 im Sieben Verlag (212 Seiten)
FBI-Agent Wayne Scott ist Telepath und deshalb ein wertvoller Mitarbeiter für die Sonderabteilung DOC †“ Department of Occult Crimes. Was ihm beruflich nützt, macht ihn privat zu einem einsamen Mann. Als er eine Serie von Fällen aufklären muss, bei denen Menschen auf unerklärliche Weise in Katatonie versetzt werden, begegnet er im Zuge der Ermittlungen Kianga Renard und stellt fest, dass sie eine ähnliche Gabe besitzt. Beide fühlen sich nicht nur deshalb sofort zu einander hingezogen. Doch Kia verbirgt ein Geheimnis und kennt offenbar den Täter. Als immer mehr Indizien darauf hindeuten, dass sie mit dem unter einer Decke steckt, gerät Wayne in einen tiefen Konflikt zwischen Liebe und Pflicht. Aber auch Kia steht vor einer schweren Entscheidung. Denn um an die Macht zu gelangen, über die sie seit ihrer Geburt verfügt, hat der Täter Wayne aufs Korn genommen und will nicht nur dessen und Kias Seele, sondern auch ihr Leben.
Über die Autorin
Mara Laue (Jahrgang 1958), begann im Alter von 12 Jahren mit dem Schreiben. Auf erste Veröffentlichungen in Schülerzeitungen folgten ab 1980 Fantasy- und Science-Fiction-Storys, Kriminal- und andere Kurzgeschichten und Gedichte in Anthologien und Fanzines sowie verschiedene Sachartikel zu diversen Themen. 1999 wurde ihr erstes (inzwischen vergriffenes Lyrik-) Buch veröffentlicht. Seit 2005 arbeitet sie als Berufsschriftstellerin und schreibt hauptsächlich Krimi/Thriller, Science Fiction, Okkult-Krimis, Dark Romance, Fantasy und Lyrik.
Im Jahr 2012 gewann sie ein „Tatort-Töwerland“-Literaturstipendium für den Kriminalroman „Brocksteins letzter Vorhang“ (erscheint 2013).
Mara Laue ist Mitglied der „Mörderischen Schwestern – Vereinigung deutschsprachiger Krimiautorinnen“ und im „Syndikat – Autorengruppe deutschsprachige Kriminalliteratur“. Nebenbei unterrichtet sie kreatives Schreiben in Workshops und Fernkursen und schreibt als Ghostwriterin Biografien und Firmenchroniken. Wenn ihr das Schreiben die Zeit dazu lässt, arbeitet sie im Nebenberuf als Künstlerin und Fotokünstlerin und hat gegenwärtig eine Ausstellung pro Jahr.
Weitere Informationen über Mara Laue finden sich auf ihrer Autorenhomepage.