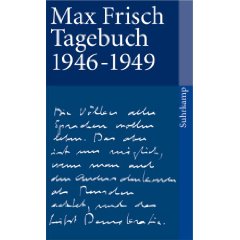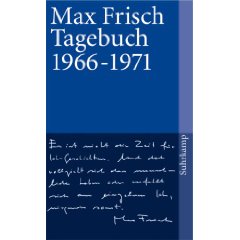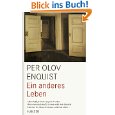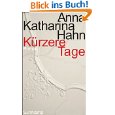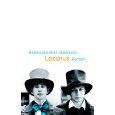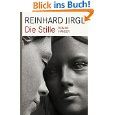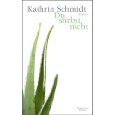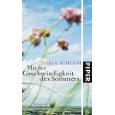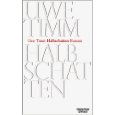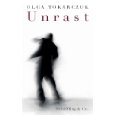Die Shortlist, bestehend aus zehn Titeln, für den Preis der SWR-Bestenliste wurde bekanntgeben. Der mit 10 000 Euro dotierte „Preis der SWR-Bestenliste“ wird von einer 30-köpfigen Jury gewählt und beim Kritikertreffen in Baden-Baden am 11. September 2009 vergeben.
Nominiert sind:
Per Olov Enquist: Ein anderes Leben, Hanser
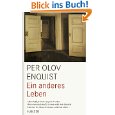 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Von einem, der als Sohn einer strenggläubigen Volksschullehrerin in einem Dorf in Schweden aufwuchs und zu einem der angesehensten europäischen Schriftsteller wurde. Per Olov Enquist erzählt seine Lebensgeschichte, als ob es die eines anderen wäre: Er studierte in Uppsala, erlebte die RAF-Zeit in West-Berlin, schrieb in München als Journalist über die Olympiade und debütierte mit seinem ersten Theaterstück am Broadway in New York. „Wenn alles so gut ging, wie konnte es dann so schlimm werden?“ – steht als Leitfrage über Enquists Biografie, die auch tief in die Alkoholabhängigkeit und an den Rand des Todes führte. Ein außergewöhnliches Buch, das sich liest wie ein zeitgenössischer Roman.
Anna Katharina Hahn: Kürzere Tage, Suhrkamp
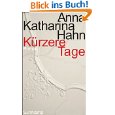 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Marco wohnt im Hochhaus an der Hauptstraße. Von hier ist es nicht weit bis zum Olgaeck, und hinter dem Olgaeck liegt die Constantinstraße, wo die Altbauten unter Denkmalschutz stehen und die Äpfel beim türkischen Feinkosthändler teurer sind als im Hauptbahnhof. Hier wohnen die Aufsteiger, Übermütter und ihre wohlerzogenen Kinder. Hier scheint alles in Ordnung – wenn man nicht vom Supermarkt ins Büro und vom Büro in den Kindergarten hetzt, so wie Leonie, wenn man nicht am Doppelleben als Karrierefrau und Mutter verzweifelt. Judith findet Halt in der Anthroposophie. Hingebungsvoll pflegt sie den Jahreszeitentisch für ihre Kleinen. Doch nachts helfen nur Tabletten gegen die Angst. Im Nebenhaus wohnen die alten Posselts. Sie haben geschafft, wovon die Enkelgeneration nur träumt, nämlich ein Leben lang zusammenzubleiben. Da versetzt Marco die Nachbarschaft in Aufruhr. Kürzere Tage ist eine wortmächtige Bestandsaufnahme und eine melancholische Abrechnung mit einer Gesellschaft, in der alle Werte fragwürdig geworden sind.
Wohlstand und Aussichtslosigkeit, Eurythmie und Hysterie, Elternglück und Kinderleid. Virtuos schildert Anna Katharina Hahn das satte Stuttgart von einer anderen Seite.
Aleksandar Hemon: Lazarus, Knaus
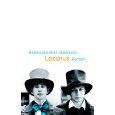 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
In seinem neuen Roman folgt Aleksandar Hemon den Spuren eines ungelösten historischen Mordfalls. Dabei entdeckt sein Held Parallelen zwischen gestern und heute, begegnet einem verschollenen Freund und macht sich auf die Suche nach den eigenen Wurzeln in einem fernen Land. Eine lakonische, höchst unterhaltsame und rasant erzählte Geschichte über politische Hysterie, Heimatlosigkeit und geplatzte Träume. Und die Geschichte einer Männerfreundschaft, die ihresgleichen sucht. Durch Zufall stößt der Schriftsteller Vladimir Brik in Chicago auf die Geschichte von Lazarus Averbuch, der 1908 während der Anarchistenunruhen erschossen wurde. Brik ist von Lazarus‘ Schicksal tief berührt und beschließt, nach Osteuropa in die Heimat des jungen Einwanderers zu reisen. Kurz vor seinem Aufbruch läuft ihm Rora über den Weg, ein Jugendfreund aus Sarajevo – und Brik weiß, dass er den idealen Reisegefährten gefunden hat. Schon damals in Sarajevo war Rora das, wovon Jungs wie Brik nur zu träumen wagten: cool, charmant, verwegen. Brik und Rora machen sich auf, die Spuren des fremden Toten zu suchen. Doch im Grunde ihres Herzens wissen sie, dass diese Reise von der Neuen in die Alte Welt eine Reise zu den eigenen Wurzeln ist.
Reinhard Jirgl: Die Stille, Hanser
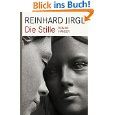 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Einhundert Jahre aus der Geschichte zweier Familien und aus der Geschichte eines Landes: Reinhard Jirgls „Die Stille“ ist das monumentale Epos vom langen 20. Jahrhundert in Deutschland. Am Anfang steht ein Fotoalbum, die ältesten Bilder sind über achtzig Jahre alt: einhundert Fotografien zweier Familien, die eine aus Ostpreußen stammend, die andere aus der Niederlausitz. Zwei Weltkriege, Inflation, Flucht und Vertreibung haben diese beiden Familien über fünf politische Systeme hinweg, von der Kaiserzeit bis heute, überlebt. Den einhundert Fotografien folgend, erzählt Jirgl Geschichten von Verletzungen, Liebe und Verrat. „Die Stille“ bestätigt seinen außergewöhnlichen Rang.
Reinhard Jirgl wurde für seinen Roman „Die Stille“ bereits mit dem Grimmelshausen-Preis 2009 ausgezeichnet.
Hans Pleschinski: Ludwigshöhe, C.H. Beck
 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Die drei Geschwister Berg – Clarissa, Monika und Ulrich – machen ein vertracktes Erbe. Ihr Onkel Robert bedenkt sie mit gewaltigen und weit verzweigten Vermögenswerten, allem voran mit einer Villa am Starnberger See. All dies könnte sie auf einen Schlag von ihrem ermüdenden, nicht unbedingt aussichtsreichen Existenzkampf befreien. Aber er macht ihnen eine Auflage: Sie müssen dieses Haus als Hort und Zufluchtsort für Lebensmüde betreiben und ihnen auch das eine oder andere nützliche Utensil bereithalten; nicht nur rechtlich eine Gratwanderung. Voller Skrupel und Ängste, aber auch scharf aufs Erbe öffnen die Geschwister die Villa an der Ludwigshöhe für eine stetig wachsende Zahl von Finalisten . Da findet sich eine verzweifelte Verkäuferin neben dem Bühnenbildner mit gewissen körperlichen Defiziten ein, eine ausgebrannte Lehrerin neben einer vereinsamten Schauspielerin, eine medikamentenabhängige Witwe neben der liebeskranken Domina, ein bankrotter Verleger, aber auch eine erst 17jährige syrische Immanitin, die Angst hat, Opfer eines Ehrenmords zu werden. Während die Geschwister den Keller des Hauses mit praktischen Kühltruhen füllen, machen die Moribunden fast gar keine Anstalten mehr, ihrem dunklen Drang zu folgen. Die alte Villa erlebt ein Fest des Lebens – der kuriosen Beziehungen, Gespräche, Annäherungen und Abstoßungen, neuer Liebe und Lebensmutes – wie es als frisches, zeitgemäßes Panorama und in brillant-unterhaltsamer Form nur Hans Pleschinski inszenieren kann.
Ein großer Roman, der ein ebenso präzises wie farbiges Bild des gegenwärtigen Lebens bietet, der Versagungen, Überforderungen und Zwänge, aber auch der Wünsche, Sehnsüchte und der Möglichkeiten, die dem Dasein auch abzugewinnen sind.
Kathrin Schmidt: Du stirbst nicht, Kiepenheuer & Witsch
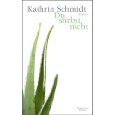 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Vom Hirnschlag erwacht – die Geschichte einer Heilung Helene Wesendahl weiß nicht, wie ihr geschieht: Sie findet sich im Krankenhaus wieder, ohne Kontrolle über ihren Körper, sprachlos, mit Erinnerungslücken. Ihr Weg zurück ins Leben konfrontiert sie mit einer fremden Frau, die doch einmal sie selbst war. Kathrin Schmidt packt ihre Leser diesmal durch die Beschränkung, und zwar im wörtlichen Sinne. Mit den Augen ihrer erwachenden Heldin blicken wir in ein Krankenzimmer, auf andere Patienten, das Pflegepersonal und den eigenen Körper, der plötzlich ein Eigenleben zu führen scheint. Und wir erleben die mühsamen Reha-Maßnahmen mit, die Reaktionen der Familie, den aufopferungsvollen Einsatz ihres Mannes – und die bruchstückhafte Wiederkehr ihrer Erinnerung. Was da zutage tritt, konfrontiert Helene mit einem Leben, in dem sie sich kaum wiedererkennt, und das vieles in Frage stellt, was in der neuen Situation so selbstverständlich scheint. Sie entdeckt frühe Brüche in ihrer Biographie, verdrängte Leidenschaften und aus der Not geborene Verpflichtungen. Als ihr bewusst wird, dass ihr Herz sich bereits auf Abwege begeben hatte und sie den Mann, der sie jetzt so eifrig pflegt, eigentlich verlassen wollte, droht sie den Boden unter den Füßen zu verlieren. Kathrin Schmidt gelingt das Erstaunliche: Sie macht den Orientierungs- und Sprachverlust nach einer Hirnverletzung erfahrbar und zeigt einen Weg der Genesung, der in zwei Richtungen führt, zurück und nach vorn. Dabei entsteht ein Entwicklungsroman ganz eigener Art, der durch seine innere Dynamik fesselt und durch die Rückhaltlosigkeit, mit der seine Heldin sich mit ihrer Vergangenheit und Gegenwart konfrontiert, fasziniert. Er überzeugt vor allem durch die bewegende Schilderung eines sprachlichen Neubeginns.
Julia Schoch: Mit der Geschwindigkeit des Sommers, Piper
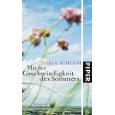 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Vor allem die Frauen waren übermütig, ihre Gesichter leuchteten, und ihr Lachen hörte man die ganze Nacht hindurch. Als hätte ihnen nun der Lauf der Geschichte, die Auflösung unseres Staates, ein Argument für ein eigenes Leben gegeben. Meine Schwester aber, die in der Abgeschiedenheit der Kiefernwälder und des Stettiner Haffs von der Freiheit geträumt hatte, hatte noch nichts, das sich zu verlassen lohnte. Nur die Familie, den Ehemann. Aber sie blieb, traf sich wieder mit ihrem alten Liebhaber und gab sich fast schwärmerisch der verlockenden Vorstellung hin, dass in diesem anderen Staat ein anderer Lebenslauf für sie bereitgestanden hätte. Wäre ich aufmerksamer gewesen, hätte ich ihre verhängnisvolle Entscheidung vielleicht rückgängig machen können.
Uwe Tellkamp: Der Turm, Suhrkamp
 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Hausmusik, Lektüre, intellektueller Austausch: Das Dresdner Villenviertel, vom real existierenden Sozialismus längst mit Verfallsgrau überzogen, schottet sich ab. Resigniert, aber humorvoll kommentiert man den Niedergang eines Gesellschaftssystems, in dem Bildungsbürger eigentlich nicht vorgesehen sind. Anne und Richard Hoffmann, sie Krankenschwester, er Chirurg, stehen im Konflikt zwischen Anpassung und Aufbegehren: Kann man den Zumutungen des Systems in der Nische, der »süßen Krankheit Gestern« der Dresdner Nostalgie entfliehen wie Richards Cousin Niklas Tietze – oder ist der Zeitpunkt gekommen, die Ausreise zu wählen? Christian, ihr ältester Sohn, der Medizin studieren will, bekommt die Härte des Systems in der NVA zu spüren. Sein Weg scheint als Strafgefangener am Ofen eines Chemiewerks zu enden. Sein Onkel Meno Rohde steht zwischen den Welten: Als Kind der »roten Aristokratie« im Moskauer Exil hat er Zugang zum seltsamen Bezirk »Ostrom«, wo die Nomenklatura residiert, die Lebensläufe der Menschen verwaltet werden und deutsches demokratisches Recht gesprochen wird. In epischer Sprache, in eingehend-liebevollen wie dramatischen Szenen entwirft Uwe Tellkamp ein monumentales Panorama der untergehenden DDR, in der Angehörige dreier Generationen teils gestaltend, teils ohnmächtig auf den Mahlstrom der Revolution von 1989 zutreiben, der den Turm mit sich reißen wird.
Uwe Timm: Halbschatten, Kiepenheuer & Witsch
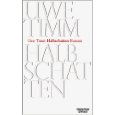 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Ein Oratorium auf eine zu allem entschlossene junge Fliegerin und eine ungelebte Liebe. Marga von Etzdorf, eine junge Fliegerin, erschießt sich im Mai 1933 in Aleppo, Syrien, nach einer Bruchlandung. Sie ist 25 Jahre alt. Ihr Grab liegt auf dem Berliner Invalidenfriedhof. Was hat sie hier, zwischen den Toten der preußischen Militärgeschichte, NS-Größen und zivilen Opfern der letzten Kriegstage, zu suchen? Gibt es eine Erklärung für ihren gewaltsamen Tod? Der Stadtführer, der Uwe Timms Erzähler über den Invalidenfriedhof geleitet, weist auf beunruhigende Nachbarschaften hin. Hier liegt nicht nur Scharnhorst, der Held der Befreiungskriege, sondern auch Heydrich, der Organisator der Judenvernichtung, neben namenlosen Opfer aus dem Mai `45. Die Toten beginnen zu reden, sich zu erklären, zu rechtfertigen. Unter den Stimmen, die zu dem Erzähler sprechen, ist auch der junge Kampfflieger Christian von Dahlem. Auf einem ihrer spektakulären Langstreckenflüge hatte Marga von Etzdorf in Japan Dahlem kennengelernt und mit ihm ein seltsame, zauberhafte Nacht verbracht – eine Nacht des Erzählens. Zusammen in einem Zimmer, aber getrennt durch einen Vorhang, waren die beiden sich fern und gewährten einander doch Nähe. In einem Augenblick innerer Preisgabe erzählen sie sich ihre Leben – und müssen sich am nächsten Morgen trennen. Dieses Oratorium des Schreckens und der Liebe, in dessen Mittelpunkt Marga und von Dahlem stehen – eine unbedingte Liebe und ein Verrat -, beschwört zugleich die Dämonen und Engel der Geschichte und erzählt von Haltungen und Sichtweisen, von denen die deutsche Geschichte geprägt und gezeichnet ist. Vielstimmig und vielschichtig, gedanken- und anspielungsreich, klug und bewegend, begibt sich dieser Roman auf ein Terrain, wo sich die Gewalt der Geschichte, der Zufall und das individuelle Schicksal begegnen, einander bestätigen, aber auch widersprechen – für den, der zu hören vermag.
Olga Tokarczuk: Unrast, Schöffling & Co.
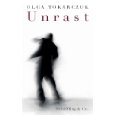 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Eine Frau und ihr kleiner Sohn verschwinden auf mysteriöse Weise während des Urlaubs; eine orthodoxe Sekte will durch ständige Bewegung dem Teufel entkommen; die Ich-Erzählerin auf permanenter Wanderschaft: In ihrem neuen Buch Unrast beschäftigt sich die große polnische Autorin Olga Tokarczuk mit der Reiselust und dem Nomadentum des modernen Menschen. In einer Vielfalt von Texten, von der Reiseerzählung über mythologische Geschichten bis zur pointierten philosophischen Betrachtung, bannt sie die Hektik des modernen Lebens in einen feinverwobenen erzählerischen Kosmos, der durch brillante Prosa besticht.
Olga Tokarczuks Figuren sind Getriebene, Flüchtende vor der Starrheit der Zuordnung, der Verwurzelung, rastlos auf der Suche nach einer immateriellen Heimat. Der Weg dorthin führt durch ein faszinierendes Labyrinth von Geschichten über Menschen, Dinge, Orte und Zeiten, die dieses Buch zu einer wahren Welt für sich machen.
„Die Reise ist wohl die größtmögliche Annäherung an das, was unsere moderne Welt zu sein scheint: Bewegung und Instabilität. Jede Epoche sieht sich versucht, den Zustand des zeitgenössischen Menschen mit irgendeinem schlauen Wort zu beschreiben. Mir scheint, dass für unsere Zeit ‚Unrast‘ ein solches Wort sein könnte.“ Olga Tokarczuk
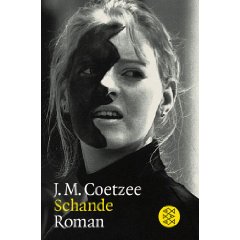 Obwohl er seiner neuen Disziplin täglich viele Stunden widmet, findet er deren erste Prämisse, wie sie im „Communications 101“-Handbuch formuliert ist, geradezu absurd: „Die menschliche Gesellschaft hat die Sprache erfunden, damit wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Absichten einander mitteilen können.“ Seiner Ansicht nach — die er für sich behält — liegen die Ursprünge der Sprache im Gesang, die Ursprünge des Gesangs wiederum in der Notwendigkeit, die übergroße und ziemlich leere menschliche Seele mit Klang zu erfüllen.
Obwohl er seiner neuen Disziplin täglich viele Stunden widmet, findet er deren erste Prämisse, wie sie im „Communications 101“-Handbuch formuliert ist, geradezu absurd: „Die menschliche Gesellschaft hat die Sprache erfunden, damit wir unsere Gedanken, unsere Gefühle und unsere Absichten einander mitteilen können.“ Seiner Ansicht nach — die er für sich behält — liegen die Ursprünge der Sprache im Gesang, die Ursprünge des Gesangs wiederum in der Notwendigkeit, die übergroße und ziemlich leere menschliche Seele mit Klang zu erfüllen.