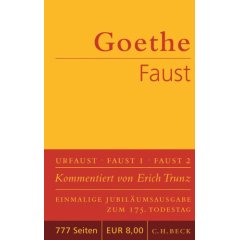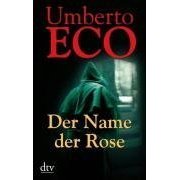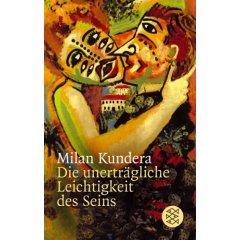†œHabe nun, ach! Philosophie,
Juristerei und Medizin,
Und leider auch Theologie!
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn.
Da steh†™ ich nun, ich armer Tor!
Und bin so klug als wie zuvor.“
Faust von Johann Wolfgang von Goethe
 Am 28. August 1749 wird Johann Wolfgang Goethe als Sohn des Kaiserlichen Rates Dr. Johann Caspar Goethe in Frankfurt am Main geboren. Mit 16 Jahren erlebt er die Kaiserkrönung Joseph II. und beginnt zwei Jahre später sein Studium der Jurisprudenz in Leipzig.
Am 28. August 1749 wird Johann Wolfgang Goethe als Sohn des Kaiserlichen Rates Dr. Johann Caspar Goethe in Frankfurt am Main geboren. Mit 16 Jahren erlebt er die Kaiserkrönung Joseph II. und beginnt zwei Jahre später sein Studium der Jurisprudenz in Leipzig.
Die Freundschaft mit der Pietistin Susanne von Klettenberg hilft Goethe bei der Überwindung einer schweren Krankheit. Unter dem Einfluss von Katharina v. Klettenberg, dem Urbild der „Schönen Seele“ (Wilhelm Meister), und der Beschäftigung mit Chemie und Alchimie erfährt der junge Goethe eine pietistisch gesteigerte Innerlichkeit und Sensibilität, die durch eine Begegnung mit Herder noch gesteigert wird.
Die Goethezeit beginnt 1770 mit Goethes Begegnung mit Herder und umfasst die Epochen Sturm und Drang, Klassik und Romantik bis zu Goethes Tod 1832.
In den Jahren 1771 – 1774 schreibt der junge Rechtsanwalt seine Werke Götz von Berlichingen und Die Leiden des jungen Werther:
„Meine Sinnen verwirren sich. Schon acht Tage habe ich keine Besinnungskraft, meine Augen sind voll Tränen……..Mir wär’s besser ich ginge.“
Zwischen 1774 – 1777 beginnt der junge Dichter seine Arbeit am Urfaust und Wilhelm Meisters theatralischer Sendung.
Nach Auflösung seiner Verlobung mit Lili Schönemann 1775 reist Goethe auf Einladung Herzog Carl Augusts von Sachsen Weimar nach Weimar, wo er Ende des Jahres ankommt. Dort begegnet er Charlotte von Stein. In den folgenden Jahren in Weimar wird Goethe einer der höchsten Beamten des Herzogtums.
1776: Beginn der Sturm und Drang Epoche. Der Sturm und Drang ist eine weitgehend auf Deutschland beschränkte Bewegung junger Schriftsteller, die sich in Straßburg und Frankfurt um Goethe sammeln. In dieser Epoche der Selbstverwirklichung hören die jungen Dichter auf ihre innere Stimme und suchen die Autonomie des Ichs. Sie sind gegen die ästhetische Regelwelt. Ihre Werke spiegeln empfindsame und moralische Aufklärung.
1786: Beginn der „Weimarer Klassik“ Der politische Hintergrund der „Weimarer Klassik“ ist die Französische Revolution mit ihren Rufen nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Der geistesgeschichtliche Hintergrund ist die aufklärende Philosophie Kants. Die Idealvorstellung der Weimarer Klassik hieß: „Natur und Welt sind frei von Willkür und Gewalt“. Das klassische Schönheitsideal postulierte die Einheit des Reinen, Wahren und Guten. Goethe setzte es vor allem in der Iphigenie um:
„Hat denn zur unerhörten That der Mann
Allein das Recht? Drückt denn Unmögliches
Nur Er an die gewalt’ge Heldenbrust?“
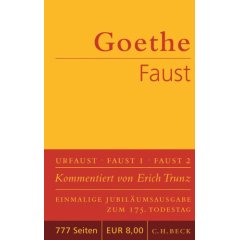 In Goethes Dichtung wird das tragische Individuum Faust durch Selbstzucht, Liebe und Gnade in das Weltganze aufgenommen. Für Goethe beginnt nun eine intensive Beschäftigung mit der Erlebnislyrik.
In Goethes Dichtung wird das tragische Individuum Faust durch Selbstzucht, Liebe und Gnade in das Weltganze aufgenommen. Für Goethe beginnt nun eine intensive Beschäftigung mit der Erlebnislyrik.
1786: Goethes Reise nach Italien Eine neue Epoche innerhalb seiner Werke beginnt. Die Venetianischen Epigramme zeigen in disziplinierter klassischer Form, wie weltoffen Goethe die neuen Eindrücke aufnahm:
„Eines Menschen Leben, was ists? Doch Tausende können
Reden über den Mann, was er und wie ers getan.
Weniger ist ein Gedicht; doch können es Tausend genießen,
Tausende tadeln. Mein Freund, lebe nur, dichte fort.“
Goethe verbindet sich mit Christiane Vulpius, und ein Jahr später wird sein Sohn August geboren.
1790 entstehen die „Römischen Elegien„, ein Zyklus aus 20 Gedichten.
„Bilder so wie Leidenschaften
Mögen gern am Liede haften“
Der Titel lässt elegische Trauer erwarten, doch schon August Wilhelm Schlegel schrieb: „Sie sind im Ton meistens munterer, als man selbst bei den alten Elegikern gewohnt ist.“
1794 – 1796 führt Goethe erste Gespräche mit Schiller. In diesen Gesprächen entsteht eine intensive Freundschaft. Goethes Werke Reineke Fuchs, Hermann und Dorothea sowie Wilhelm Meisters Lehrjahre entstehen.
1796: Beginn der Literaturepoche der Romantik In den neunziger Jahren wendet sich Goethe immer stärker klassischen Dichtungsformen zu. Eins und Alles, ‚Vermächtnis‘ und ‚Weltseele‘ entstehen in dieser klassischen Periode.
„Verteilet euch nach allen Religionen
Von diesem heiligen Schmaus!
Begeistert reißt euch durch die nächsten Zonen
Ins All und füllt es aus!“
1800 – bis 1820 arbeitet Goethe an seinen Werken ‚Faust, zweiter Teil‘, Wilhelm Meisters Wanderjahre, Die Wahlverwandtschaft, Dichtung und Wahrheit, Italienische Reise und ‚Östlicher Divan‚.
Mit Schillers Tod 1805 zeigt sich der Beginn eines Umbruchs in den Dramen und der Lyrik Goethes. Der Dichter greift in diesen nachklassischen Jahren zunehmend zu fremden Stoffen, zu Formen und Masken. Er schöpft aus dem Fundus der Weltliteratur, was oft kritisiert wurde.
1828 ist der Umbruch in der Lyrik Goethes vollendet. Die späten Gedichte sind voller Ursprünglichkeit und Klarheit des Geistes. Naturlyrik voller Religiosität findet man hier ebenso wie reflexionsfreie Liebeslyrik.
1831 vollendet Goethe sein Werk Faust, zweiter Teil. Ein Jahr später, am 22. März, 1832, stirbt der Dichter.
„Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis;
Das Unzulängliche
Hier wird’s Ereignis“
Goethe verkörperte das Ideal seiner Zeit. Beeinflusst vom Geist der Aufklärung, glaubte er an die Vernunft.
 Friedrich „Fritz“ Walter
Friedrich „Fritz“ Walter Am 28. August 1749 wird
Am 28. August 1749 wird