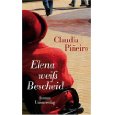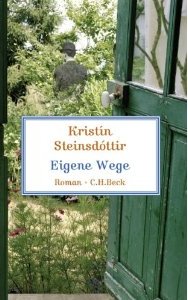Simone Veil erhält den Heinrich-Heine-Preis 2010
Die 82-jährige französische Publizistin und Politikerin Simone Veil erhält den mit 50 000 Euro dotierten Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf. Der Heinrich-Heine-Preis zählt zu den bedeutendsten deutschen Literaturpreisen.
„Zeit ihres öffentlichen Engagements ist Veil für die Menschenrechte und die Verständigung der Völker eingetreten. Ganz im Sinne Heinrich Heines hat sie dazu beigetragen, Europa eine Seele zu geben†œ, begründete die Jury am 02.07.2010 ihre Entscheidung.
Simone Veil wurde am 13. Juli 1927 in Nizza als Tochter des Architekten André Jakob geboren. Im Ersten Weltkrieg verbrachte er mehrere Jahre in Kriegsgefangenschaft. Die Familie war jüdisch und aus kulturellen Gründen stolz auf das Judentum, jedoch nicht religiös, sondern weltlich, republikanisch und patriotisch eingestellt.
1944 wurde Veil und ihre Familie von der Gestapo verhaftet. Sie wurde im Gestapo-Hauptquartier, dem Hotel „Excelsior“, verhört. Ihr Vater und ihr Bruder Jean wurden nach Litauen deportiert. Beide kamen nicht zurück. Ihre Schwester Denise war bei der Resistance, wurde ins KZ Ravensbrück verschleppt, konnte jedoch überleben. Simone, ihre Mutter und ihre andere Schwester Madeleine, genannt Milou, wurden ins KZ Auschwitz-Birkenau deportiert.
Die Selektion bei der Ankunft in Auschwitz überlebte sie, da sie vortäuschte bereits 18 Jahre alt zu sein. Im Januar 1945 machte sie zusammen mit der Mutter der Schwester den Todesmarsch von Auschwitz zum KZ Bergen-Belsen. Ihre Mutter Yvonne Jakob starb am 15. März 1945 in Bergen Belsen an der Typhusepidemie. Kurz danach, am 15. April 1945, wurden Simone und ihre Schwester Milou in Bergen-Belsen von den englischen Streitkräften befreit.
Simone Veil studierte am Institut d’études politiques de Paris. Die ausgebildete Juristin Veil gehörte von 1974 bis 1979 den Kabinetten Jacques Chiracs und Raymond Barres als Gesundheitsministerin an. Sie war die erste Frau auf einem Ministerposten in Frankreich. In ihrer Funktion als Gesundheitsministerin sorgte sie für einen erleichterten Zugang zu Verhütungsmitteln †“ der Verkauf von Verhütungsmitteln wie der Pille war in Frankreich erst 1967 legalisiert worden. Mit ihrem Namen am meisten verbunden ist jedoch ihr harter Kampf für die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in Frankreich (17. Januar 1975).
Nach ihrem Ausscheiden aus der Regierung kandidierte sie für die UDF als Spitzenkandidatin bei den ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979. Dieses wählte Veil zur Präsidentin. Sie war die erste Frau, die dieses Amt innehatte. Aufgrund einer interfraktionellen Absprache legte sie dieses Amt in der Mitte der fünfjährigen Legislaturperiode Anfang 1982 nieder.
Unter Premierminister Édouard Balladur war Simone Veil zwischen 1993 und 1995 Ministerin für Soziales, Gesundheit und Stadtwesen im Range einer Staatsministerin und von 1998 bis 2007 Mitglied des französischen Verfassungsrats.
Sie zählt noch heute zu den beliebtesten Französinnen. Im vergangenen März war Veil offiziell in die Riege der 40 „Unsterblichen†œ der berühmten Académie Française aufgenommen worden.
Simone Veil wurde unter anderem mit dem Europäischen Karlspreis (1980) und dem Prinz- von-Asturien-Preis (2005) ausgezeichnet.
Zuletzt erschien von Simone Veil „Und dennoch leben: Die Autobiographie der großen Europäerin“ im Februar 2009 im Aufbau Verlag.
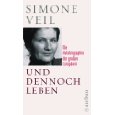 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Sie ist eine der bekanntesten Politikerinnen Europas und verkörpert vor allem eines: das Streben nach Unabhängigkeit und Freiheit. Nach ihrer Deportation und dem Kriegsende wird die dreifache Mutter zur »Madame le Ministre« unter Jacques Chirac. Ihr Kampf für die »Loi Veil«, die Legalisierung der Abtreibung, geht in die Geschichtsbücher ein. Neben Helmut Kohl und François Mitterrand wird sie zur Galionsfigur der europäischen Gemeinschaft. In ihren Erinnerungen berichtet sie fesselnd vom Austausch mit Politikerinnen wie Hillary Clinton oder Margaret Thatcher und schildert spannende Begegnungen mit den Mächtigen ihrer Zeit: Helmut Schmidt, Bill Clinton, George Bush, Nelson Mandela, Papst Johannes Paul II.
„Ich fühle mich sehr geehrt und nehme den Heine-Preis mit Freuden an†œ, sei Simone Veils erste Reaktion gewesen, als sie telefonisch über die Auszeichnung informiert wurde. Der Preis soll im kommenden Dezember überreicht werden.
Unter den bisherigen Heine-Preisträgern sind Carl Zuckmayer (1972), Max Frisch (1989), Richard von Weizsäcker (1991), Hans Magnus Enzensberger (1998), Elfriede Jelinek (2002). Im Rahmen der für 2006 geplanten Preisvergabe, welche den Höhepunkt der Feierlichkeiten zum 150. Todesjahr Heinrich Heines darstellen sollte, entschied das Preisgericht, den Preis Peter Handke zu verleihen und löste damit einen Skandal wegen Handkes differenzierten Betrachtung der Person MiloŠ¡evićs sowie der Balkankriege gegenüber aus. Handke lehnte den Preis ab. 2008 wurde Amos Oz mit dem Heinrich-Heine-Preis geehrt.