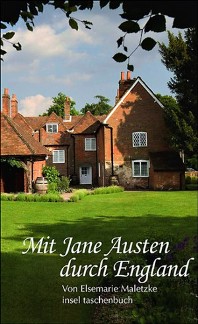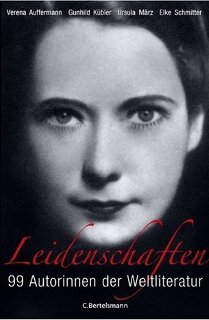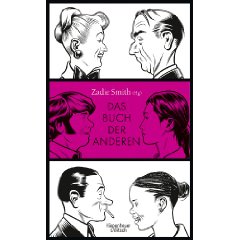Zum artgerechten Umgang mit Frauen von Dr. Rainer K. Liedtke
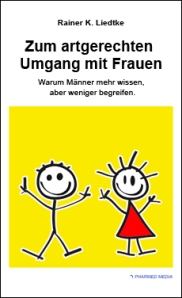 Ironische Spekulationen zu biologischen Ursachen für unser unterschiedliches Verhalten bei Gefühl und Erfahrung.
Ironische Spekulationen zu biologischen Ursachen für unser unterschiedliches Verhalten bei Gefühl und Erfahrung.
Der ewige Streit zwischen Mann und Frau führte dazu, daß manche Experten nun behaupten, ein erfolgreiches Zusammenleben dieser beiden Arten sei wenig wahrscheinlich oder gar unmöglich. Wie wir es von Experten erwarten, ist solche Behauptung nicht ganz neu. Sagte doch schon der alte Konfuzius, wenn auch in anderem Zusammenhang, †œWenn über das grundsätzliche keine Einigkeit besteht, ist es sinnlos, miteinander Pläne zu machen†œ.
Daher möchte auch ich mich dieser Sache einmal versuchsweise nähern. Zunächst benötigen wir dazu unsere beliebtesten gegenseitigen Vorurteile. Diese lassen sich meiner Meinung nach relativ leicht in zwei Punkten zusammenfassen:
Frauen kommen schon erwachsen auf die Welt,
Männer werden nie erwachsen
 Dazu noch ein grundsätzlicher Aspekt: Männer wie Frauen beeinflussen gern andere Menschen. Sie tun es um damit †œwichtig† zu werden. Dort nun fängt meiner Meinung aber gleich schon unser Dilemma an. Männer und Frauen haben ja verschiedene Sichtweisen zum Leben. Um für andere †œwichtig† zu sein, verfolgt der Mann für sich eher das Ziel an mehr rohe Macht zu kommen. Hingegen versucht die Frau für sich damit mehr soziale Anerkennung zu erreichen. Auf dem Weg dahin scheinen Frauen insgesamt konfliktärmer vorzugehen als wir Männer. Dies erkläre ich mir vor allem damit, daß bei ihnen seltener der Typus des Wichtigtuers auftaucht.
Dazu noch ein grundsätzlicher Aspekt: Männer wie Frauen beeinflussen gern andere Menschen. Sie tun es um damit †œwichtig† zu werden. Dort nun fängt meiner Meinung aber gleich schon unser Dilemma an. Männer und Frauen haben ja verschiedene Sichtweisen zum Leben. Um für andere †œwichtig† zu sein, verfolgt der Mann für sich eher das Ziel an mehr rohe Macht zu kommen. Hingegen versucht die Frau für sich damit mehr soziale Anerkennung zu erreichen. Auf dem Weg dahin scheinen Frauen insgesamt konfliktärmer vorzugehen als wir Männer. Dies erkläre ich mir vor allem damit, daß bei ihnen seltener der Typus des Wichtigtuers auftaucht.
Daß dies nun alles so ist, dabei spielen unsere Hirn-Funktionen eine wichtige Rolle. Hiermit meine ich nicht Unterschiede zwischen uns im Sinne von „schlauer†œ oder „dümmer†œ. Es scheinen unsere unterschiedlichen inneren Schaltkreise zu sein, über die alte Gefühls-Programme der Evolution unser Hirn steuern. Schließlich entwickelten wir uns ja erst noch über ein paar etwas einfacher gestrickte Vorstufen. Das startete in der Urzeit bekanntlich noch ziemlich ohne Technik. Seitdem erschufen wir uns dann aber eine ganze Zahl Hilfsmittel, die vorwiegend unserer erhöhten Bequemlichkeit dienen. Soweit es die biologische Weiterentwicklung unseres Hirns betrifft, vermute ich dort eher einen gewissen Stillstand.
Wie auch immer, auch heute setzt sich unser tägliches Verhalten aus Dingen zusammen, die wir gerne in „logisches Denken†œ und „Emotion†œ einteilen. Da wir Männer spekulieren, die Logik sei das Wichtigere, haben wir diese auch für uns gepachtet. Auf kleinere Webfehler komme ich ja noch zu sprechen. Zumindest kann ich es hier schon mal so weit zusammenfassen: Die unterschiedliche Wahrnehmung bei Mann und Frau ermöglicht uns stets gut zu ganz verschiedenen Schlußfolgerungen zu kommen.
Daher sah ich mich hier aufgerufen auch auf ein paar der Ursachen und deren zwangsläufige Folgen hinzuweisen. Der Weg zur artgerechten Kooperation hieß im übrigen auch einzubeziehen, wie unsere eigene männliche Art so tickt.
Meine Weisheiten bezog ich nicht nur aus theoretischer Wissenschaft und Philosophie. Ich sammelte sie auch bei meinen Freiland-Beobachtungen zu speziellen Arten von Frauen und Männern. Das führte dann zu einigen Spekulationen. So drängte sich mir verschiedentlich die Frage auf: Gibt es möglicherweise doch einen höheren positiven Sinn der Evolution, daß wir mit unserem Wunderwerk Gehirn oft nichts anderes anzufangen wissen als uns so aufzuführen, wie wir es eben tun?
Rainer K. Liedtke
[adsense format=text]
„Sture Männer aller Gewichts- und Altersklassen nutzen das Schüren von Konflikten, um ihren Machtstatus und ihr Prestige aufzumöbeln. Eine verblödete Männerhorde, die ihnen nachlatscht, findet sich immer. Und so wird Liedtkes Paar-Studie im Grunde zu einer kleinen, mit viel Witz gespickten Welt-Gesellschafts-Studie: „Machtstreben stört Harmonie … Verzicht auf Dominanz wandelt Konflikte“.
Das Erwärmende bei Liedtke: Er nimmt sich nicht aus. Er hat Vieles von dem, was Männer an Verwirrungen so mit sich schleppen, auch im eigenen Verhalten erlebt. Man merkt ja oft erst im Nachhinein, wie bestimmte Dinge fast automatisch geschehen. Aber dann ist auch ein guter Zeitpunkt, darüber nachzudenken. Übrigens auch für die weiblichen Heldinnen der Geschichte, die zwar das Meiste dazu beitragen, dass der Homo Sapiens bis heute überlebt. Aber oft genug stärken sie auch falsches männliches Verhalten.“ Drängler, Protzer, Kriegsgewinner: Zum artgerechten Umgang mit Frauen – Leipziger Internetzeitung, 01.01.2010
Über den Autor Dr. Rainer K. Liedtke
 Medizin war eher ein Zufall. Statt Arzt zu werden plante Rainer K. Liedtke erst ein Studium der Soziologie. Er nahm aber dann, in letzter Minute, einen ihm angebotenen Studienplatz für Medizin an. Das Studium finanzierte er teils über Auftritte als Gitarrist einer Beat-Gruppe, als Bauarbeiter, sowie als wissenschaftlicher Hilfsassistent an der Universität. Zudem sammelte er erste schriftstellerische Erfahrungen als freier Redakteur bei medizinischen Journalen.
Medizin war eher ein Zufall. Statt Arzt zu werden plante Rainer K. Liedtke erst ein Studium der Soziologie. Er nahm aber dann, in letzter Minute, einen ihm angebotenen Studienplatz für Medizin an. Das Studium finanzierte er teils über Auftritte als Gitarrist einer Beat-Gruppe, als Bauarbeiter, sowie als wissenschaftlicher Hilfsassistent an der Universität. Zudem sammelte er erste schriftstellerische Erfahrungen als freier Redakteur bei medizinischen Journalen.
Das Interesse an Arzneimitteln entstand über den Weg. So machte er seinen Doktor der Medizin mit Forschungen zu DNA und RNA am biochemischen Institut der Universität Bonn. Dem folgten weitere Studien in der molekularen Medizin. Hiernach kamen mehrere Jahre praktische Tätigkeit als Krankenhausarzt, danach weitere Jahre in wissenschaftlichen Positionen der pharmazeutischen Industrie. Parallel hielt er als Universitäts-Lehrbeauftragter Vorlesungen in Pharmakologie. Neben wissenschaftlichen Publikationen veröffentlichte er mehrere medizinische Fachbücher, medizinische Patienten-Informationen und Artikel zu gesellschaftlich wichtigen medizinischen Entwicklungen. Hinzu kam die Erstellung von über hundert Patentschriften vor allem in Pharmazie, Medizin, Informationstechnik. Daß darunter auch noch ein Patent †œWindsurfboard mit Doppelrumpf-Bug†œ existiert, liegt eher an seinem früheren Hobby Windsurfing.
Als Gründer einer Deutschen und US Pharma-Firma war Rainer K. Liedtke dann einige Jahre in New York tätig. Zu Entdeckungen und Entwicklungen hier gehören u.a. die transdermale Schwangerschafts-Verhütung, Schmerz-Pflaster gegen Rückenschmerz (das diesbezüglich erste Marktprodukt in den USA), antidepressive Eigenschaften des Hormons Oxytocin. Nach seiner Rückkehr nach München folgten wieder theoretische Wissenschaft und Publikationen einer †˜Allgemeinen Theorie des Schmerz†™ sowie eines Modells zur Entstehung bestimmter Nebenwirkungen von Schmerzmitteln. Mehr Information zur Wissenschaft: www.rkliedtke.de.
Als Schriftsteller hat er seine Interessen an Soziologie wieder intensiviert mit dem Leitspruch:
„Fachwissen schließt Humor nicht aus†œ