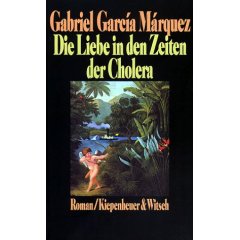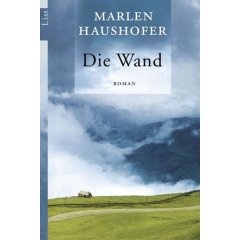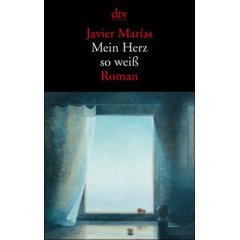Mein erster und einziger Besuch bei einem Therapeuten kostete mich das rote Korallenarmband und meinen Geliebten.
„Sommerhaus, später“ von Judith Hermann
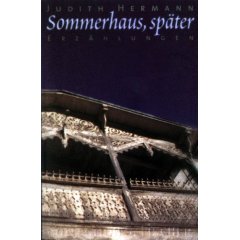 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung
Zwei Frauen, die auf einer Insel ein Spiel spielen, das »sich so ein Leben vorstellen« heißt. Ein Premierenfest, das ein unerwartetes, frühmorgendliches Ende in der Wohnung des Regisseurs findet. Ein Mann, der in seinem Sommerhaus an der Oder Besuch erhält und an seine Vergangenheit erinnert wird, die er nicht mehr kennen will.
Judith Hermanns Figuren inszenieren sich ihr Leben, sie lassen sich nur passiv oder als Zuschauer, nur spielerisch in »Lebensläufe« ziehen. Es ist ihr Gespür für die Zwischentöne und die subtilen Unaufrichtigkeiten der Gegenwart, das ihre Geschichten so eindrucksvoll macht. Die Gedanken der Helden und Heldinnen kreisen immer wieder um dieselben Themen: um Liebe und Vergänglichkeit und die Angst vor dem ungelebten, dem verhinderten Leben. Die Enkelin, die von ihrer ans Bett gefesselten Großmutter erzählt, der alte Mann, der in einer New Yorker Absteige einer jungen Reisenden begegnet – sie spüren, wie die Zeit an ihnen vorübergezogen ist. Alle aber ahnen, daß sich ihr Leben nicht in der Gegenwart, sondern in der Erinnerung und in der Vorstellung zuträgt, daß Liebe und Vergänglichkeit letztlich zwei Worte für dasselbe sind.
Aus der Amazon.de-Redaktion
Eine Menge Vorurteile werden mit Judith Hermanns Debütwerk beseitigt: Erstens, es gibt doch gute deutsche Nachwuchsautoren, zweitens, die Gattung der Erzählung ist nicht tot, und drittens, deutsches Schreiben ist per se nicht schwerfällig und grüblerisch, sondern kann, so zeigt Sommerhaus, später, sehr leichtfüßig und virtuos daherkommen.
Die Erzählperson schlüpft in neun Geschichten in verschiedene Rollen und Geschlechter: Mal ist sie Enkelin, mal Geliebte, mal Künstler, mal Zuhörer. Und manchmal auch bloß Erzählerin. So schnell sie eine Intimität zum Leser aufbaut, so schnell endet die Geschichte auch wieder und es beginnt eine neue. Personen treten in das Leben der Protagonisten und gehen wieder, reißen kleine Wunden, die lange schmerzen. Da ist der alte, einsame Mann, der seine Klassikkassetten einem jungen Mädchen schenkt, obwohl sie ihn versetzt; oder Sonja, die wie ein naives Kind in einen Maler verliebt ist und dann wie ein Geist wieder aus seinem Leben verschwindet. Gute und Böse gibt es nicht, nur Unvermögen oder Großzügigkeit.
Hermanns Kunst ist unmittelbar: direkte Rede, reale Vergleiche, detaillierte Wahrnehmung. Und doch bleiben die Erzählungen angenehm unvollständig. Als hätte jemand eine Kamera auf ein paar Personen in Berlin oder New York oder sonstwo gehalten und wieder ausgeblendet. „Du musst lernen zu warten“, sagt einer ihrer Protagonisten, „auch auf die kleinen Ereignisse“.
Judith Hermann hat für Sommerhaus, später den Förderpreis des Bremer Literaturpreises 1999 erhalten. In der Begründung der Jury heißt es: „Judith Hermann formuliert in atmosphärisch dichter Prosa und mit großer sprachlicher Sicherheit das Lebensgefühl von Menschen, die in Liebe und Angst befangen, das wirkliche Leben verfehlen und das Scheitern der eigenen Lebenspläne mehr melancholisch beobachten als trauernd erleben.“ –Bettina Albert
 Über die Autorin
Über die Autorin
Judith Hermann wurde am 15. Mai 1970 im St. Joseph-Krankenhaus in Berlin-Tempelhof geboren. Sie begann ein Germanistik- und Philosophie-Studium mit der Absicht, im Anschluss als Journalistin zu arbeiten. Sie brach dieses ab und entschied sich für ein Praktikum in New York. Dort besuchte sie die Journalistenschule. 1997 erhielt sie das Alfred-Döblin-Stipendium der Akademie der Künste in Berlin. In Amerika schrieb sie ihre ersten literarischen Texte und entdeckte bald die Kurzgeschichte als „ihr†œ Genre. 1998 veröffentlichte sie schließlich ihren ersten Prosaband Sommerhaus, später.
Nach ihrem ersten Erfolg verstrichen mehrere Jahre, in denen sie †“ nach eigener Aussage †“ lernen musste, mit dem Druck, der nun durch Verlage, die Medien und die Öffentlichkeit in Form eines erwartungsvollen Publikums auf sie ausgeübt wurde, umzugehen.
Sie ist Mutter eines Sohnes und lebt und schreibt in Berlin/Prenzlauer Berg.
2003 folgte der zweite Erzählungsband Nichts als Gespenster.
Sommerhaus, später
Hermann gelang der literarische Durchbruch mit ihrer Erstpublikation, dem Erzählungsband Sommerhaus, später. Gelobt wurden dabei ihre in kurzen Sätzen gehaltenen, doch trotzdem unschlüssig bleibenden Schilderungen alltäglicher und scheinbar alltäglicher Begebenheiten. Hermann skizziert in ihren melancholisch gefärbten kurzen Erzählungen die Stimmungen der Personen und die feinen Nuancen in wenigen Worten. Durch dieses Verfahren wirken ihre Erzählungen sehr atmosphärisch und aufgeladen, zugleich vermeidet Hermann es, große Gefühle direkt auszusprechen oder klar zu benennen. Diese Technik hat ihre direktesten Vorfahren in den Storys des amerikanischen Schriftstellers Raymond Carver, auf den Hermann sich in Interviews und Preisreden immer wieder bezogen hat.