Der erste Satz:
Dieses Buch soll weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen, über eine Generation zu berichten, die vom Krieg zerstört wurde †“ auch wenn sie seinen Granaten entkamen.
„Man darf nicht den Kampf verschieben und sich die bürgerliche Person des Autors vornehmen, (dessen Haltung nach einem in der Geschichte des deutschen Buchhandels beispiellosen Erfolg mustergültig ist). Der Mann erzählt uns keine dicken Töne, er hält sich zurück; er spielt nicht den Ehrenvorsitzenden und nicht den Edelsten der Nation – er läßt sich nicht mehr photographieren, als nötig ist, und man könnte manchem engeren Berufsgenossen so viel Takt und Reserve wünschen, wie jener Erich Maria Remarque sie zeigt.“
Kurt Tucholsky
„Ein vollkommenes Kunstwerk und unzweifelhaft Wahrheit zu gleich“
Stefan Zweig
„Ein heißes Eisen in charmanter Hand“
Heinrich Böll
Im Westen nichts Neues von Erich Maria Remarque
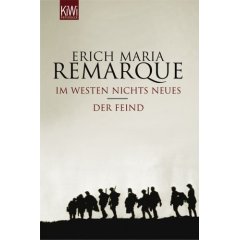 Der Roman von Erich Maria Remarque erschien 1929. Das Buch gehört zu der Gruppe von Werken, in denen – rund zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs – das Kriegserlebnis des Frontsoldaten geschildert und direkt oder indirekt Anklage erhoben wurde gegen den Krieg; es erschien im selben Jahre wie Ernest Hemingways „A Farewell to Arms“ („In einem anderen Land“), ein Jahr nach Ernst Glaesers (1902-1963) „Jahrgang 1902“ und Ludwig Renns „Krieg“, drei Jahre nach Hemingways „The Sun Also Rises“ („Fiesta“). Bei Remarque fällt wie auch bei Hemingway das Wort von der „verlorenen Generation“, die nach dem Krieg nicht mehr in der bürgerlichen Gesellschaft Fuß fassen kann, weil sie im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren schon zu viel Grauen erlebt hat und dem Tod zu oft ins Auge sehen mußte, um vergessen zu können.
Der Roman von Erich Maria Remarque erschien 1929. Das Buch gehört zu der Gruppe von Werken, in denen – rund zehn Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkriegs – das Kriegserlebnis des Frontsoldaten geschildert und direkt oder indirekt Anklage erhoben wurde gegen den Krieg; es erschien im selben Jahre wie Ernest Hemingways „A Farewell to Arms“ („In einem anderen Land“), ein Jahr nach Ernst Glaesers (1902-1963) „Jahrgang 1902“ und Ludwig Renns „Krieg“, drei Jahre nach Hemingways „The Sun Also Rises“ („Fiesta“). Bei Remarque fällt wie auch bei Hemingway das Wort von der „verlorenen Generation“, die nach dem Krieg nicht mehr in der bürgerlichen Gesellschaft Fuß fassen kann, weil sie im Alter von achtzehn bis zwanzig Jahren schon zu viel Grauen erlebt hat und dem Tod zu oft ins Auge sehen mußte, um vergessen zu können.
Ähnlich wie Renn schildert Remarque den Krieg aus der Perspektive des einfachen Soldaten, des gemeinsam mit seinen Klassenkameraden von der Schule direkt aufs Schlachtfeld geschickten Paul Bäumer. Die Begeisterung, die ihn wie seine Kameraden zu Anfang des Kriegs erfüllte, wird ihm schon durch die Schikanen bei der Ausbildung ausgetrieben, durch Kasernenhoftyrannen vom Schlage des als Typ sprichwörtlich gewordenen Unteroffiziers Himmelstoß, durch den unsinnigen Drill, der nicht einmal für das Überleben in wirklicher Gefahr nützt. „Auf eine sonderbare und schwermütige Weise verroht“, schlagen der Erzähler und seine Freunde sich dann durch das Leben als Frontsoldaten, das sich zwischen „Trommelfeuer, Verzweiflung und Mannschaftsbordells« abspielt und das sie zu – „:Menschentieren“ – macht. Als das einzig Positive erscheint die an der Front entstehende Kameradschaft quer durch alle Dienstgrade. Die mörderischen Kämpfe, der Stellungskrieg, die Materialschlachten, die Gasangriffe, die nächtlichen Patrouillen durch zerschossene Wälder, das hundertfache Sterben ringsumher kehren mit fast stereotyper Gleichförmigkeit wieder und ähneln den vergleichbaren Schilderungen in vielen andern Kriegsbüchern: kaum reflektiert, in einer einfachen Report-Sprache, nur bisweilen von melancholischem Pathos gefärbt und ohne jeden Ton von Hoffnung. Der Roman ist durchaus unpolitisch; nur ein einziges Mal entspannt sich zwischen den Soldaten eine Diskussion über die Ursache von Kriegen, die aber völlig schematisch und abstrakt bleibt. Diese Fragen bleiben ungelöst für den Ich-Erzähler, der wie ein kurzer Schlußpassus mitteilt – als letzter der Gruppe von Schulkameraden im Oktober 1918 an einem Tag fällt, an dem „der Heeresbericht sich nur auf den Satz beschränkte, im Westen sei nichts Neues zu melden“.
Obwohl der Autor in einem Vorspruch betont, das Buch solle „weder eine Anklage noch ein Bekenntnis sein. Es soll nur den Versuch machen über eine Generation zu berichte die vom Kriege zerstört wurde auch wenn sie seinen Granaten entkam“, wurde „Im Westen nichts Neues“ doch nicht nur als Bericht, sondern als Anklage gegen den Krieg und vor allem auch gegen die Erwachsenen verstanden, gegen die Eltern und Lehrer, die diese „eiserne Jugend“ mit chauvinistischen Reden in den Krieg trieben. Die Feindschaft der älteren Generation, die Remarque auf sich gezogen hatte, konnte von den Nationalsozialisten noch einmal politisch ausgemünzt werden: Joseph Goebbels organisierte 1930 Krawalle gegen die Verfilmung des Romans, und ab 1933 gehörte „Im Westen nichts Neues“ während des NS-Regimes zur verbotenen und verbrannten Literatur in Deutschland. Der Roman hatte dennoch, wohl gerade wegen seines kargen, beschreibenden Tons und der darin spürbaren bitteren Resignation, außerordentlichen Erfolg und fand, in 32 Sprachen übersetzt, weltweite Verbreitung.
 Hat es Verletzte gegeben?
Hat es Verletzte gegeben?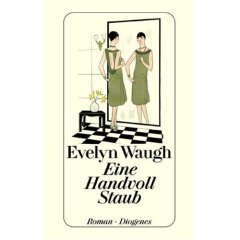 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung Die Autorin
Die Autorin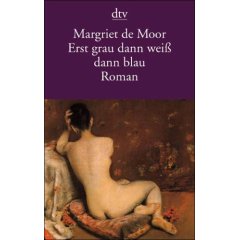 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung Françoise Sagan (eigentlich Françoise Quoirez), geboren am 21. Juni 1935 in Cajarc, Département Lot, gestorben am 24. September 2004 in Honfleur, Département Calvados, war eine französische Schriftstellerin und über viele Jahre Frankreichs erfolgreichste Bestseller-Autorin. Mehrere ihrer Romane wurden verfilmt. Ihr Pseudonym bezieht sich auf den Herzog von Sagan, eine Romanfigur von Marcel Proust.
Françoise Sagan (eigentlich Françoise Quoirez), geboren am 21. Juni 1935 in Cajarc, Département Lot, gestorben am 24. September 2004 in Honfleur, Département Calvados, war eine französische Schriftstellerin und über viele Jahre Frankreichs erfolgreichste Bestseller-Autorin. Mehrere ihrer Romane wurden verfilmt. Ihr Pseudonym bezieht sich auf den Herzog von Sagan, eine Romanfigur von Marcel Proust.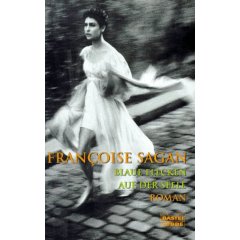 Kurzbeschreibung
Kurzbeschreibung