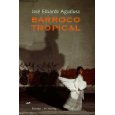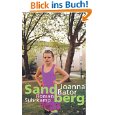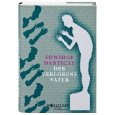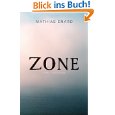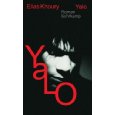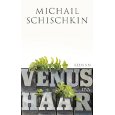Das Haus der Kulturen der Welt hat sechs Bücher für die Shortlist zum „Internationalen Literaturpreis †“ Haus der Kulturen der Welt 2011“ nominiert. Der Preis für internationale Erzählliteratur wird seit 2009 jährlich durch das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen vergeben. Er ist mit 35.000 Euro dotiert. 25.000 Euro erhält der Autor und 10.000 Euro der Übersetzer. Bis zum 25.02.2011 haben deutschsprachige Verlage insgesamt 111 Titel eingereicht. Die Jury, bestehend aus namhaften Literaturkritikern, Journalisten, Übersetzern und Autoren, werden den Preisträger am 15.06.2011 bekanntgeben. Die Preisverleihung findet in Anwesenheit der Preisträger am 29.06.2011 in Berlin statt. Moderiert wird der Abend von der ZDF-Kulturjournalistin Luzia Braun, die Festrede hält der Übersetzer und Schauspieler Hanns Zischler. Der Schauspieler Ulrich Matthes wird aus der deutschen Übersetzung lesen und der Preisträger Auszüge aus dem Originaltext vorstellen.
Das Haus der Kulturen der Welt hat sechs Bücher für die Shortlist zum „Internationalen Literaturpreis †“ Haus der Kulturen der Welt 2011“ nominiert. Der Preis für internationale Erzählliteratur wird seit 2009 jährlich durch das Haus der Kulturen der Welt und die Stiftung Elementarteilchen vergeben. Er ist mit 35.000 Euro dotiert. 25.000 Euro erhält der Autor und 10.000 Euro der Übersetzer. Bis zum 25.02.2011 haben deutschsprachige Verlage insgesamt 111 Titel eingereicht. Die Jury, bestehend aus namhaften Literaturkritikern, Journalisten, Übersetzern und Autoren, werden den Preisträger am 15.06.2011 bekanntgeben. Die Preisverleihung findet in Anwesenheit der Preisträger am 29.06.2011 in Berlin statt. Moderiert wird der Abend von der ZDF-Kulturjournalistin Luzia Braun, die Festrede hält der Übersetzer und Schauspieler Hanns Zischler. Der Schauspieler Ulrich Matthes wird aus der deutschen Übersetzung lesen und der Preisträger Auszüge aus dem Originaltext vorstellen.
Die nominierten sechs Titel, ihre Autoren und Übersetzer (in alphabetischer Reihenfolge):
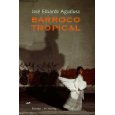 Barroco Tropical von Agualusa, José Eduardo -Â aus dem Portugiesischen von Michael Kegler
Barroco Tropical von Agualusa, José Eduardo -Â aus dem Portugiesischen von Michael Kegler
Kurzbeschreibung
Dem Schriftsteller Bartolomeu Falcato fällt eine Frau buchstäblich vor die Füße. Allerdings nicht aus heiterem Himmel, sondern aus einem Unwetter heraus, und es ist klar, dass sie nicht freiwillig gestürzt ist.
Bei der Toten handelt es sich um Núbia de Matos, Model und angebliche Ex-Geliebte der Präsidentin. Nur fünf Tage zuvor hatte sie Falcato in der Abflughalle des Flughafens angesprochen, ihn bedrängt und pikante Details aus den Hinterzimmern der politischen Eliten erzählt. Doch statt sich um die Aufklärung des mysteriösen Todesfalls kümmern zu können, wird Falcato selbst zum Verfolgten. Ominöse Anrufer warnen ihn, in seineWohnung zurückzukehren. Und auch seine Frau darf nicht wissen, was er zur fraglichen Zeit am fraglichen Ort zu suchen hatte, und vor allem nicht, mit wem
Was folgt, ist eine rasante Odyssee durch den Untergrund und die Abgründe der angolanischen Hauptstadt Luanda. 24 Stunden, in denen Falcato selbst in einen Strudel aus skrupelloser Gewalt, Leidenschaft und Eifersucht gerät. Und dann sind da noch die schwarzen Engel, die auf den Dächern der Hochhausruinen tanzen, die seit dem Ölboom überall in Luanda in den Himmel ragen. Hirngespinste? Realität gewordene afrikanische Mythen?
José Eduardo Agualusa schafft in seinem im Jahr 2020 angesiedelten Roman ein filmisches und poetisches Panoptikum Angolas aus vermeintlichen Trugbildern und politischer Realität.
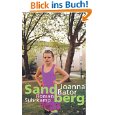 Der Sandberg von Joanna Bator – aus dem Polnischen von Esther Kinsky
Der Sandberg von Joanna Bator – aus dem Polnischen von Esther Kinsky
Kurzbeschreibung
Die rebellische Dominika mit dem dunklen Teint und der »Zigeunermähne« ist eine Außenseiterin. In der Klasse fühlt sie sich zu den Mitschülern hingezogen, die anders sind: zu Dimitri, dem Sohn griechischer Exilanten, und zu Malgosia, ihrer lesbischen Freundin. Das Leben im »Sandberg«, der heruntergekommenen Plattenbausiedlung am Rande einer westpolnischen Kleinstadt, ödet sie an: der Dreck, der Suff; ihre Mutter, die von einem Schwiegersohn aus Castrop-Rauxel träumt; die von Kirche und Konsumwahn manipulierten Nachbarsfrauen. Was geht sie das an? Wie kommt sie überhaupt hierher? Geliebt fühlt sich Dominika nur von ihren Großmüttern †“ Halina, die im »Deutschenhaus« in der Altstadt wohnt, und Zofia, die sich 1943 das Leben nehmen wollte. Eines Tages, als sie bei Zofia im Garten unter dem Walnußbaum sitzt, taucht ein Historiker aus Kalifornien auf, der die Spur eines jüdischen Freundes verfolgt und wie beiläufig ins Gespinst der Lebenslügen hineinsticht, aus dem Dominika sich befreien will. Joanna Bator, die wohl stärkste neue Stimme der polnischen Literatur, erzählt in einer reichen, sinnlichen Sprache und mit giftiger Ironie von den Träumen, Ängsten und Hoffnungen einer von Krieg und Flucht traumatisierten Generation und von der Rebellion und Freiheitssehnsucht ihrer Kinder.
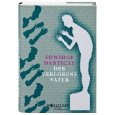 Der verlorene Vater von Edwidge Danticat – aus dem Englischen von Susann Urban
Der verlorene Vater von Edwidge Danticat – aus dem Englischen von Susann Urban
Kurzbeschreibung
Neun Geschichten über einen Mann, der von Haiti in die Vereinigten Staaten ausgewandert ist †“ angeblich auf der Flucht vor dem Duvalier-Regime, von dem er verfolgt und gefoltert wurde. Äußeres Zeichen dieses Schicksals ist eine lange Narbe. Erst im Erwachsenenalter erfährt seine in New York geborene Tochter, dass ihr Vater keineswegs Opfer, sondern Täter war, ein Mann, der alle Finessen des Folterns beherrschte, der das Leben unzähliger Menschen zerstörte. Die einzelnen in sich abgeschlossenen Kapitel zeichnen das Bild der haitianischen Gesellschaft zwischen Armut, Willkürherrschaft, Flucht und Auswanderung. Es kommen Menschen zu Wort, denen das Leben unter der paradiesischen Sonne Haitis zur Hölle wurde.
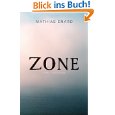 Zone von Mathias Énard – aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
Zone von Mathias Énard – aus dem Französischen von Holger Fock und Sabine Müller
Kurzbeschreibung
Francis Mirkovic, alias Yves Deroy, sitzt im Pendolino von Mailand nach Rom, inkognito und erster Klasse reisend, und über ihm, mit einer Handschelle an der Gepäckstange gesichert, ein Metallkoffer voller Dokumente und Fotos – der „Koffer voller Toten“. Er enthält die Listen von Kriegsverbrechern, Waffenhändlern und Terroristen, die Francis als Agent des französischen Geheimdienstes in den Konfliktzonen des Mittelmeerraums zusammengestellt hat und an den Vatikan verkaufen will, um ein neues Leben zu beginnen. Erschöpft von Alkohol und Amphetaminen lässt er seinen Erinnerungen freien Lauf – an die Entsetzlichkeiten des Balkankrieges, in die er zwei Jahre als Söldner verwickelt war, an die Freunde, die neben ihm starben, an die Menschen von Algier bis Jerusalem, die er ausspionierte, an die Frauen, die er liebte: Stéphanie, die kein Kind „mit einem Barbaren wie ihm“ wollte, oder Sashka, die vielleicht noch in Rom auf ihn wartet. In einem einzigen Satz des symphonisch gestalteten inneren Monologs, im Stakkato des Nachtzugs, mäandernd, sich wiederholend, springt der Erzähler von Ereignis zu Ereignis – vom Blutbad der christlichen Phalange in Beirut 1982 zu Mussolinis Nordafrikakrieg, vom Den Haager Kriegsverbrecherprozess zu seinem Vater, der auf französischer Seite im Algerienkrieg folterte -, benennt die Gräuel aus der Geschichte und Gegenwart des Mittelmeers, die sich zu einem homerischen Fresko der Gewalt formen. Mit seinem Roman Zone erweist der junge Autor Énard einem Epos über den Krieg Reverenz, das zur Gründungsakte der europäischen Literatur wurde: Homers Ilias.
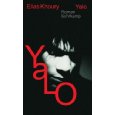 Yalo von Elias Khoury – aus dem Arabischen von Leila Chammaa
Yalo von Elias Khoury – aus dem Arabischen von Leila Chammaa
Kurzbeschreibung
So wie für Lawrence Durrell das alte Alexandria die Hauptstadt der Erinnerung war, ist für Elias Khoury das wiederaufgebaute Beirut die Hauptstadt der Amnesie. Yalo, der aus einer christlich-syrianischen Familie stammt, wächst in Beirut auf. Jung gerät er in eine der Milizen des Krieges. Nach dessen Ende wird er Wächter eines Waffenhändlers. In den Hügeln außerhalb Beiruts überfällt er nächtens Liebespaare, raubt und vergewaltigt †“ und verliebt sich in eines seiner Opfer, Shirin. Sie zeigt ihn an. Er wird festgenommen und gefoltert. Man zwingt ihn, sein Leben aufzuschreiben, immer neu, denn nie sind die Folterer zufrieden †“ selbst wenn er zugibt und ausmalt, was er gar nicht getan hat. So gerät Yalo außer sich. Im Schmerz trennt er sich von seinem Körper und erfindet sich im Geist. Mit jeder neuen Fassung verändert sich die Beschreibung, sie reichert sich an, sie franst aus, verschmutzt, färbt sich, oszilliert, sie nimmt ein Sprach- und Eigenleben an: Yalo †“ ein libanesisches Leben in Zeiten des Kriegs und Nachkriegs. Elias Khourys sprachmächtiger Roman erzeugt †“ mitreißend und erkenntnisstiftend zugleich †“ einen Taumel.
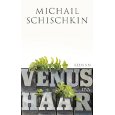 Venushaar von Michail Schischkin – aus dem Russischen von Andreas Tretner
Venushaar von Michail Schischkin – aus dem Russischen von Andreas Tretner
Kurzbeschreibung
Warum haben Sie Asyl beantragt? Diese Frage muss der namenlose Erzähler mehrfach täglich ins Russische übersetzen. Er arbeitet als Dolmetscher für die Schweizer Einwanderungsbehörde bei Vernehmungen von Flüchtlingen aus der ehemaligen Sowjetunion. Doch beim Übersetzen des fremden Leids legt sich seine eigene Lebensgeschichte wie eine zweite Schicht um die Worte. Auch er ist ein Emigrant, der sich nach denen sehnt, die er nicht mehr um sich hat: nach seiner Frau und seinem Kind. Und plötzlich treten dem Dolmetscher neben seinen eigenen Erinnerungen und Gefühlen auch Geschichten aus anderen Welten und Zeiten entgegen. Auf faszinierende Weise erzählt Schischkin ein Jahrhundert russischer Geschichte und bettet außerdem das Leben des Dolmetschers durch Verweise in einen Kosmos der gesamten Weltkultur ein. „Venushaar† ist eine vielstimmige Parabel auf das verlorene Paradies †“ kunstvoll komponiert, stilistisch virtuos.
________________________________________________________________________________________
„Die Themen der eingereichten Werke sind so politisch wie privat: Liebe, Flucht, Asyl, Vaterliebe und Bruderkriege kennzeichnen das Spektrum; dahinter die Frage nach Menschlichkeit in finsteren Zeiten. Die kulturelle und geographische Vielfalt der Shortlist, die auch eine Vielfalt von Stimmen und Schreibweisen ist, zeigt einmal mehr, wie verwoben unsere Welt längst ist: Ein Schriftsteller aus Angola, der in Portugal lebt, ein Russe, der in der Schweiz Asylsuchende betreut, eine Haitianerin, die, in den USA aufgewachsen ist, von der Vergangenheit nicht loskommt, und eine Polin, die in enormer Dichte die großen Verwerfungen im kleinen Plattenbauleben einfängt†œ, teilte Marie Luise Knott, Mitglied der diesjährigen Jury, mit.
Quelle: Haus der Kulturen der Welt