 Solange ich zurückdenken konnte, hatte ich im Waisenhaus gelebt.
Solange ich zurückdenken konnte, hatte ich im Waisenhaus gelebt.
Die Wilden von Harold Robbins
Harold Robbins, geboren am 21. Mai 1916 in New York, gestorben am 14. Oktober 1997 in Palm Springs, Kalifornien, war ein US-amerikanischer Schriftsteller.
Der Sohn russischer und polnischer Einwanderer wurde als Harold Rubin geboren. Nach Abschluss der High School arbeitete Robbins in zahlreichen Jobs, um schließlich in Hollywood zu landen und erhielt Arbeit bei den Universal Studios. Die Arbeit beim Film prägte zahlreiche seiner späteren Romane. Doch zunächst veröffentlichte er 1948 seinen Erstlingsroman. Never love a stranger ist die Geschichte eines Waisenkindes, das in New York City aus dem Nichts zu einem erfolgreichen Gangster aufsteigt. Bei seinem Debüt zeigt sich bereits die kräftige Sprache Robbins, die ihn zu einem der meistverkauften Autoren spannender Unterhaltungsliteratur machen und dafür sorgen, dass seine Bücher von Hollywood verfilmt werden, jedoch von Literaturkritikern verachtet werden.
Never love a stranger ist dann auch sein erstes Buch, das von Robert Stevens 1958 verfilmt wird, mit John Drew Barrymore (Vater der Schauspielerin Drew Barrymore) in der Hauptrolle.
An der Frage, ob seine Romane (und davon hat er etliche geschrieben) zu den Werken der Weltliteratur zählen, scheiden sich allerdings die Geister. Zumindest war der Autor so populär, dass ihm sein Lebenswerk einen Stern auf dem †œWalk of Fame† in Hollywood eingetragen hat.
Sein damaliger Verleger hat diesen Roman veröffentlicht, weil †“ um es salopp mit des Autors eigenen Worten und in meiner Übersetzung zu sagen †“ †œes das erste Mal war, dass er ein Buch gelesen hatte, bei dem er auf einer Seite weinen musste und auf der folgenden Seite einen Ständer kriegte†.
Heute würde man vielleicht eher sagen: Es ist eine stimmige Mélange aus spannendem Gangsterthriller und anrührender Liebesgeschichte, gewürzt mit einer kräftigen Prise Erotik. Und es ist trotz des Ich-Erzählers keine Autobiographie, dafür war der Autor zu jener Zeit doch noch zu jung (obwohl: wenn ich an Daniel Küblkotz & Konsorten denke…). Aber er kannte sich aufgrund seiner Herkunft auf den verschlungenen Pfaden des Großstadtdschungels recht gut aus.
†œDie Wilden† ist mit Sicherheit kein sonderlich anspruchsvolles Werk, und H.R. war auch als Mensch ein schlimmer Finger, der kein Laster ausgelassen hat. Aber er hat schließlich auch noch andere Bücher geschrieben, da ist sein Roman †œDie Gnadenlosen† (†A Stone for Danny Fisher†) schon ein ganz anderes Kaliber.
Und auch die Verfilmung mit Elvis Presley ragt aus dem ansonsten seichten filmischen Schaffen des Kings heraus †“ auch wenn die Tonspur von †œMein Leben ist der Rhythmus† in der deutschen Fassung nur in Mono ist, was dem Musikgenuss ein wenig abträglich ist. Aber ich will mich nicht beklagen †“ wenn der ursprünglich für die Hauptrolle vorgesehene James Dean den Danny Fisher gespielt hätte, hätte zwar der aus physiologischen Gründen auf diesen fixierte weibliche Teil der Bevölkerung noch mehr gekreischt, uns allen wäre aber der musikalische Genuss vollständig verwehrt geblieben…
Mein Tipp: Wenn euch †œDie Gnadenlosen† oder †œDie Macher† (†Tycoon†) von 1997 (auf Deutsch 1998) mal antiquarisch über den Weg laufen, schaut einfach mal rein.
Harold Robbins verkaufte Auflagen werden weltweit übrigens auf über 750.000.000 Stück geschätzt!
Don Farrago am 26. November, 2007
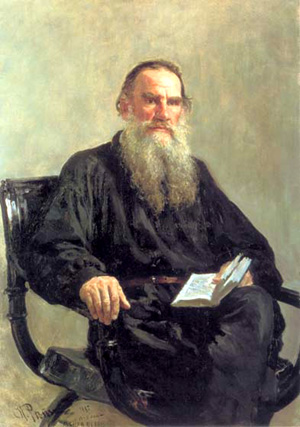 Um das Jahr 1800, in jenen Zeiten, als es noch keine Eisenbahnen gab, keine Chausseen, keine Gasbeleuchtung, keine Stearinkerzen, keine niedrigen Sofas mit Sprungfedern, keine unlackierten Möbel, keine blasierten Jünglinge mit Monokel, keine freidenkerischen weiblichen Philosophen, keine holden Kameliendamen, an denen unsere Zeit so reich ist – in jenen naiven Zeiten, als man im Reisewagen oder in einer Kutsche von Moskau nach Petersburg reiste und eine Unmasse häuslicher Küchenerzeugnisse mitnahm, volle acht Tage auf weichen, staubigen oder morastigen Landstraßen unterwegs war und auf Koteletts Posharski, waldaische Glöckchen und Kringel schwor, da an langen Herbstabenden die Talglichter herunterbrannten und Familienkreise von zwanzig, dreißig Menschen beleuchteten, als bei Bällen Wachs- und Walratkerzen auf die Armleuchter gesteckt wurden, als man die Möbel symmetrisch aufstellte, als unsere Väter noch jung waren, nicht allein durch das Fehlen von Runzeln und grauen Haaren, und sich um der Frauen Willen schossen und diensteifrig vom anderen Zimmerende herbeistürzten, um zufällig oder nicht zufällig fallengelassene Taschentücher aufzuheben, als unsere Mütter kurze Taillen und gewaltige Ärmel trugen und Familienangelegenheiten durch das Ziehen von Loszettelchen entschieden, als die verführerischen Kameliendamen sich vor dem Tageslicht versteckten – in den naiven Zeiten der Freimaurerlogen, der Martinisten, des Tugendbundes, in den Zeiten von Männern wie Miloradowitsch, Dawydow, Puschkin – fand in der Gouvernementsstadt K. nach Beendigung der Adelswahlen eine Versammlung von Gutsbesitzern statt.
Um das Jahr 1800, in jenen Zeiten, als es noch keine Eisenbahnen gab, keine Chausseen, keine Gasbeleuchtung, keine Stearinkerzen, keine niedrigen Sofas mit Sprungfedern, keine unlackierten Möbel, keine blasierten Jünglinge mit Monokel, keine freidenkerischen weiblichen Philosophen, keine holden Kameliendamen, an denen unsere Zeit so reich ist – in jenen naiven Zeiten, als man im Reisewagen oder in einer Kutsche von Moskau nach Petersburg reiste und eine Unmasse häuslicher Küchenerzeugnisse mitnahm, volle acht Tage auf weichen, staubigen oder morastigen Landstraßen unterwegs war und auf Koteletts Posharski, waldaische Glöckchen und Kringel schwor, da an langen Herbstabenden die Talglichter herunterbrannten und Familienkreise von zwanzig, dreißig Menschen beleuchteten, als bei Bällen Wachs- und Walratkerzen auf die Armleuchter gesteckt wurden, als man die Möbel symmetrisch aufstellte, als unsere Väter noch jung waren, nicht allein durch das Fehlen von Runzeln und grauen Haaren, und sich um der Frauen Willen schossen und diensteifrig vom anderen Zimmerende herbeistürzten, um zufällig oder nicht zufällig fallengelassene Taschentücher aufzuheben, als unsere Mütter kurze Taillen und gewaltige Ärmel trugen und Familienangelegenheiten durch das Ziehen von Loszettelchen entschieden, als die verführerischen Kameliendamen sich vor dem Tageslicht versteckten – in den naiven Zeiten der Freimaurerlogen, der Martinisten, des Tugendbundes, in den Zeiten von Männern wie Miloradowitsch, Dawydow, Puschkin – fand in der Gouvernementsstadt K. nach Beendigung der Adelswahlen eine Versammlung von Gutsbesitzern statt. Hört her! nun fangen wir an.
Hört her! nun fangen wir an.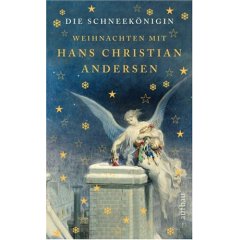 Andersen schrieb mehr als 160 Märchen in acht Bänden. Dabei bearbeitete er Volksmärchen, bis sie seinem literarischen Ansprüchen genügten und von Kindern verstanden werden konnten.
Andersen schrieb mehr als 160 Märchen in acht Bänden. Dabei bearbeitete er Volksmärchen, bis sie seinem literarischen Ansprüchen genügten und von Kindern verstanden werden konnten.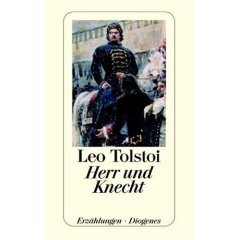 Herr und Knecht von Leo Tolstoi
Herr und Knecht von Leo Tolstoi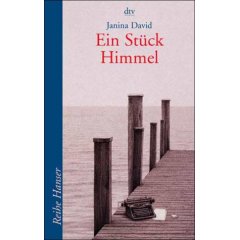 Der Geruch von reifenden Äpfeln und Birnen erfüllt den kleinen Raum.
Der Geruch von reifenden Äpfeln und Birnen erfüllt den kleinen Raum.